Haben Sie jemals einen Manager den folgenden Satz sagen hören?
„Qualität interessiert uns nicht, ebenso wenig die Bedürfnisse unserer Kunden, und wir haben auch kein Interesse daran, sie mit den besten Produkten und Dienstleistungen auf Grund lage effizienter Prozesse zu versorgen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn wir als Sickergrube enden, in der der Steuerzahler sein Geld für Subventionsprogramme versenken kann.“ Natürlich nicht – aber man fragt sich, warum so viele Unternehmen genau so handeln.
Wenn Sie sich die Listen der Fortune-500-Unternehmen 1955 und 2017 ansehen, dann können Sie feststellen, dass nur 60 Namen auf beiden Listen stehen. 440 wurden ersetzt durch früher kleinere Firmen oder Startups. Jedes einzelne der größten Unternehmen der Welt war ein Startup der letzten 40 Jahre: Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Facebook, Amazon.
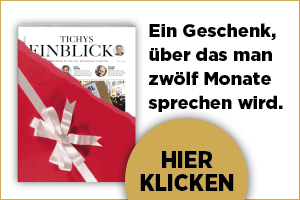
Die Governance von Unternehmen wird von zwei in Wechselwirkung stehenden Faktoren bestimmt: Der eine ist, wie sich eine Firma organisiert, der andere besteht aus den regulatorischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer das Unternehmen arbeitet. Die Wechselwirkung zwischen diesen beiden arbeitet langfristig zum Schaden der großen, saturierten Unternehmen, die mit großen Bilanzen, Aktiennotierungen, Besitzständen und Besitzstandsgruppen (die nennt man jetzt Stakeholder, um die korrupte Natur von Hinterzimmerdeals zu beschönigen), intransparenten Entscheidungswegen und einer Armee von Rentenjägern in ihren Reihen daherkommen. Das regulatorische Rahmenwerk schafft dabei erst die Bedingungen korporativer Bürokratie und feudaler Kämpfe.
Durch das Ignorieren eines der fundamentalen Bausteine einer erfolgreichen Wirtschaftsordnung, nämlich des Privateigentums und der Identität von Macht über Ressourcen mit Verantwortung für die Folgen ihrer Verwendung, kann diese korporative Bürokratie entstehen. Derjenige, der die Kontrolle ausübt, muss belohnt oder bestraft werden für die effektive und effiziente oder die ineffektive und ineffiziente Nutzung dieses Assets. Diese Identität ist das konstitutionelle Merkmal von privatem Eigentum. Wenn Ihnen etwas nicht gehört, dann investieren Sie nicht annähernd so viel Gedanken, Zeit und Mühe in die optimale Verwendung, als wenn Sie Eigentümer wären.
Um sicherzustellen, dass Ihre Firma die richtigen Dinge tut, führt kein Weg daran vorbei, diese Identität von Kontrolle und Verantwortung herzustellen. Das heißt: Langfristig geht es nicht dar um, wie man es macht, sondern was uns dazu bringt, es so zu machen.
Bürokratisierung bringt Untergang
Die Rechtsform großer Unternehmen ist fast ohne Ausnahme die der Aktiengesellschaft, wenn man einmal von der überschaubaren Zahl sehr großer Unternehmen im Familienbesitz absieht. Unternehmen werden von überlebensgroßen Gründerpersönlichkeiten geschaffen, sie wachsen, erlangen eine dominierende Stellung, werden in Aktiengesellschaften umgewandelt und treten dann ihren langen Weg in die Bedeutungslosigkeit an. Auf dem Weg dieses Abstiegs werden gewaltige Mengen an Kapital, Ressourcen, menschlichen Talenten und Arbeit vergeudet. Manch mal wird der Verfall verlangsamt oder sogar unterbrochen, aber früher oder später gewinnen die Kräfte der Entropie die Oberhand.
Solch eine Geschichte war General Electric, wo Jack Welsh das Kriegsglück für fast 20 Jahre wenden konnte. Welsh führte ein Anreizsystem ein, das Eigentum simulierte, indem es Einkommen und unternehmerischen Erfolg verknüpfte. Wer Gewinne erwirtschaftete, bekam sehr hohe Boni. Nach seinem Abschied stellte sich heraus, dass ihm das im traditionellen Nichtfinanzgeschäft besser gelungen war als im Finanzdienstleistungsarm des Unternehmens.
Im Finanzsektor gibt es schlicht mehr Möglichkeiten, ein Modell simulierten Eigentums auszutricksen: Man nimmt einfach Risiken in Kauf, deren zeitliche Struktur so beschaffen ist, dass sie erst zum Tragen kommen, nachdem man sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
Wenn Entscheidungen vom tatsächlichen Eigentümer getroffen werden, kann er sich nicht selbst betrügen. Alle Entscheidungen, gute und schlechte, transparente oder intransparente, werden auf ihn zurückfallen. Das ist die eigentliche Natur des privaten Eigentums: Es ist ökonomisches Karma. Was immer man damit tut, es kommt wieder, man muss mit den Folgen leben und kann sie nicht abwälzen.
Um nicht zu dieser einfachen Einsicht zu gelangen, erfindet die Industrie, für die ich seit 25 Jahren mit Unterbrechungen arbeite, immer neue Managementmoden. Diese Moden – einige von ihnen sind recht erfolgreich – verlangsamen den Prozess des Unternehmensverfalls, aber sie können ihn nur verzögern, jedoch nicht wirklich aufhalten, weil die juristische Konstruktion der Aktiengesellschaften Eigentum und Kontrolle voneinander trennt.
Je mehr Schichten von Holdings und Zwischenholdings die Aktiengesellschaft von ihren Aktionären trennt, je mehr Aktien von Vermögensverwaltern verwaltet werden, wo ihre Stimmrechte von den eigentlichen Eigentümern de facto abgetrennt sind, je mehr Überkreuzverflechtungen börsennotierter Gesellschaften, desto größer wird die Distanz zwischen dem eigentlichen Eigentümer und der Managerkaste, die die Kontrolle über die Verwendung der Assets ausübt. In diesem Sinne sind ETFs nur ein weiterer Sargnagel für das vom Privateigentum angetriebene Unternehmertum.
Die großen Gesellschaften sind angefüllt mit den Angehörigen einer Managerklasse, die die besten Businessschulen auf dem Globus durchlaufen haben, und sie verfügen über einen kompletten Werkzeugkasten, um Abteilungen, Unterabteilungen, Hauptabteilungen, Arbeitsgruppen, Geschäftseinheiten, Cost-Center und Verwaltungsräte zu führen. Aber sie sind keine Eigentümer.
Fehlkonstruktion Aktiengesellschaft
Sie klettern die Leiter des Großunternehmens nicht dafür nach oben, dass sie das Beste für die Eigentümer tun, sondern dafür, dass sie das Beste für ihre Vorgesetzten tun. Wenn Sie dann oben angekommen sind, haben sie gelernt, das Beste für sich selbst zu tun.
Und ihre Vorgesetzten durchlaufen die gleiche Schule, und so geht es durch das Organigramm bis zum Vorstandsvorsitzenden und zu dessen Vorgänger, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Fisch der organisatorischen Fehlkonstruktion Aktiengesellschaft stinkt vom Kopf her, nicht weil das schlechte Menschen wären, sondern weil sie Teil einer dysfunktionalen Governance sind.
Das Management großer Aktiengesellschaften wird gegen die Eigentümer abgeschirmt. Die resultierende Governance zieht auch keine Unternehmertypen an. Sie zieht graue Anzüge an – Bürokraten, Administratoren, die es sich hübsch einrichten in ihren gemütlichen Nischen. Was sie auf keinen Fall wollen, ist Veränderung. Deshalb ist Change-Management als Managementmode auch so unglaublich haltbar: Man kann damit bei Höchstgeschwindigkeit auf der Stelle rennen.
Wenn wir sie auf Dauer erfolgreicher machen wollen, müssen wir scharf darüber nachdenken, wie wir die Aktiengesellschaft verbessern können. Ihr Motto ist: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“ Sie übersehen dabei leider, dass der, der dies sagt, am Ende nass sein wird, aber nicht gewaschen.


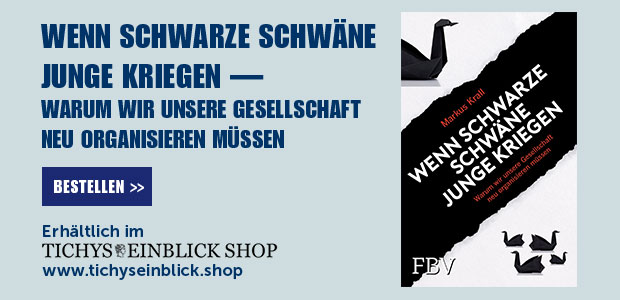
‚ Nieten in Nadelstreifen ‚ hat es immer und überall gegeben, und es wird sie auch weiterhin geben, ohne dass dies normativ für die Geschäftsführungen der Aktiengesellschaften wäre. Es gibt wahrscheinlich auch kein perfektes System für ‚corporate governance ‚. Alle zitierten 440 Firmen, die heute in der Fortune 500-Liste stehen und in 1975 nicht in der Liste standen, sind auch wieder Aktiengesellschaften – nach amerikanischem Recht und amerikanischen Finanzmarktgegebenheiten. So schlecht scheint es doch wieder nicht zu funktionieren. Die deutschen Bedingungen sind dann wieder auf alt-deutsche Weise speziell, aber sie sind nicht nur schlecht. Es gäbe da rechtlich und finanzmarktbezogen eine Menge aufzuräumen. Die Rechte der Aktionärsversammlungen, der Rechte und Verantwortungen der Aufsichtsräte, und last but not least, die Vertragscharakteristika der Vorstände sind verbesserungsfähig. Mein Vorschlag wäre bei den Vorständen anzufangen. Sie dürften nur sehr beschränkt ‚Angestellte der Gesellschaft‘ sein, d.h. ein Festgehalt von maximal € 500 Tsd/Jahr. Firmenpensionen wären dann proportional auf dieses Gehalt beschränkt – wie bei leitenden Angestellten eben. Alle darüber hinausgehenden Vergütungen und Versorgungsleistungen wären Gewinnverwendung, d.h. wie Dividenden, aus versteuerten Gewinnen zu bezahlen und von der HV regelmässig zu genehmigen, auch Abfindungen bei vorzeitiger Vertragsauflösung. Die Aktionäre/HV könnten dann ihren Vorständen in Geld, Aktien und/oder Optionen soviel bezahlen wie sie wollen. Sie würden wahrscheinlich niemanden mit Vergütung/Versorgung überschütten, der den Laden ruiniert hat.
Sehr wichtiges Thema. Ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit einem alten Freund: Er war der Meinung, dass ein guter Manager jede Firma führen könne. Es wäre egal, ob die Firma Staubsauger, Spielekonsolen oder Musikinstrumente produzieren und/oder verkaufen würde.
Ich sehe das auch heute noch anders. Wer das Produkt aus persönlicher Erfahrung genau kennt, weil er es selbst nutzt, kann den Markt und die Mitbewerber viel besser einschätzen.
Wer nun sein eigemes Unternehmen aufbaut, hat meist genau diesen Background. Kein Mensch macht sich in einer Branche selbstständig, zu der er keinen Bezug hat, oder er geht meist schnell insolvent.
Ein Manager, der die Führung eines bereits bestehenden Unternehmens übernimmt, hat diesen Background oft nicht, „lebt“ das Produkt nicht und mutiert zum schnöden Verkäufer.
Der Fokus rückt weg vom Produkt, hin zum Ertrag. Was die Aktionäre zwar toll finden, oftmals aber den Ausverkauf einläutet.
Derzeit wunderbar bei Apple zu beobachten. Seit Steve Jobs tot ist, fehlen die revolutionären Ideen, die Produktqualität geht runter und der Preis dafür rauf. Langfristig wird Apple dabei seinen Ruf einbüßen, Kunden verlieren und vom Markt verschwinden. Die Aktionäre haben dabei zwar ein gutes Geschäft gemacht, aber die Ideenschmiede, die einst die Welt revolutionierte, wird untergehen.
Daraus erklärt sich doch einzig der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager!
Der Unternehmer unternimmt etwas, und zwar sehr häufig im eigens von ihm gegründeten Unternehmen.
Ein Manager tut so, als täte er etwas zum Wohle des Unternehmens, entstammt einer eng gefassten Kaste und ist lediglich daran interessiert, die betriebswirtschaftlichen Stellschrauben zu bedienen, die ihm mehr Renomee und vor allem Geld einbringen!
„Aktiengesellschaften fehlt der Eigentümer“.
Die Aussage in der Allgemeinheit ist falsch. Die Aktionäre sind die Eigentümer. Sie sind alle Teilhaber der Firma. Der englische Ausdruck „Shareholder“ für Aktionär sagt das viel klarer aus.
Das Problem ist: Der Kleinaktionär kann nichts durchsetzen. Die Aktionäre wählen zwar den halben Aufsichtsrat. (Die andere Hälfte wählen die Arbeitnehmer.) Die Mehrheit der Aktien einer Gesellschaft liegen bei den Banken, bei den Fonds, und den professionellen Investoren. Die besetzen den Aufsichtsrat. Das Verfahren ist im Prinzip demokratisch, aber Demokratie findet trotzdem nicht statt.
Ob ein Kleinaktionär dem Aufsichtsrat das Vertrauen ausspricht oder nicht, juckt keinen Aufsichtsrat. Selbst, wenn Vorstand oder Aufsichtsrat Fehler machen, passiert denen in aller Regel nichts. Die Aktionäre haben das Nachsehen, wenn die Aktie des Unternehmens massiv einbricht.
Bei Familienunternehmen liegt die soziale Verantwortung bei den Familien. Wenn hier ein Fehler gemacht wird, leidet in erster Linie die Eigentümer-Familie. Das kann bis in die persönliche Insolvenz gehen. Da scheint über Konsequenzen mehr nachgedacht zu werden als in den Aktiengesellschaften.
Viele Unternehmensprobleme entstehen durch Übernahmen. Das Ziel ist ein immer größeres Unternehmen, ein immer größerer Umsatz und damit ein steigender Verdienst der Vorstände. Wenn der Käufer sich verkauft hat, dann ist der Schaden schon entstanden. Beispiele: Warum hat Bayer Monsanto gekauft? Die Probleme mussten vorhersehbar sein. VW hat Rolls Royce gekauft, aber nur die alten Fabrikgemäuer, nicht die Namensrechte. Wie konnte das passieren?
Umgekehrt: Deutsche AGs werden von Chinesen, Indern, Arabern und anderen reichen Ausländern gekauft. Der normale Deutsche kauft keine Aktien und lässt das damit zu. Als Friedrich Merz meinte, dass Deutsche mehr Aktien kaufen sollte, wurde er dafür fertig gemacht.
Großes Problem – einfachste Lösung:
Nur natürliche Personen, welche Persönlich bei der Hauptversammlung erscheinen, haben ein Stimmrecht!
Wäre doch sicher von wert mal über diesen Satz zu Diskutieren, oder nicht?
Hören Sie einfach mal den Analysten zu, lesen Sie was die so von sich geben, dann wissen Sie auch, was Manager unisono plappern werden. Derzeit ist „Nachhaltigkeit“ und „soziale Verantwortung“ und CO2 Einsparung ein Hype. Einfach Lageberichte lesen und das Gefasel der Manager gegenüber stellen.
Einmal jährlich gibts einen Volunteering Day, da werden Bäumchen gepflanzt, Kinder bespaßt und seit diesem Jahr auch mal ein Altenheim besucht – das erscheint im Lagebericht, dann werden die Mitarbeiter „animiert, motiviert“ das Auto stehen zu lassen, den ÖPNV nutzen und so zur CO2 Einsparung beizutragen – auch das erscheint im Lagebericht, wie so mancher andere Stuss und die Analysten ergötzen sich dann oder drehen den Daumen nach unten. Im Prinzip alles ein großer Fake.
Aude pensare.
Um bei Herrn Hellenberg anzuknüpfen. Die Idee der Aktiengesellschaft ist aus dem bis heute weltweit geltenden Geld- und Zinsmonopolen und dazu den Bodenmonopolen von Fürst/Staat entstanden, die es erforderlich machen, zu vorher vereinbarten Zeitpunkten den Zins und Zinseszins für die Inanspruchnahme des Existenzmittels Geld und Boden zu zahlen. Und in der arbeitsteiligen Wirtschaft ist Geld eindeutig ein Existenzmittel. Wer es nicht in Anspruch nimmt, wird keine Bleibe finden (in der Miete ist ein hoher Anteil der Zins) und wird verhungern müssen, weil Kapital für die Gründung einer Produktion mitsamt erforderlichen Arbeitskräften und dem Verkauf des Produkts unumgänglich ist. Meistens ist es dann ein risikobereiter Unternehmer der dem Unselbständigen eine Arbeitsstelle anbietet. Er muss aber vorher den zu zahlenden Zins für die Inanspruchnahme des Kapitals von seinem und dem Lohn des Arbeitnehmers abziehen.
Um dem Zwang der kontinuierlichen Zahlungen von Zinsen und Zinseszins gerade bei erforderlicher Inanspruchnahme von hohen Kapitalsummen zu entgehen, wurde die Idee der Aktiengesellschaft geboren. Der Aktionär und damit Kapitalgeber kann nämlich die kontinuierliche Zinszahlung nicht fordern, sondern muss abwarten bis die AG Gewinne macht, die eine Ausschüttung der Dividende erlauben.
Wir sollten uns endlich einmal darüber nachdenken, ohne in sozialistische Ideen zu verfallen, wie eine freiheitliche funktionierende Marktwirtschaft auch ohne Zins ermöglicht werden kann.
Ergo: Das Geld- und Zinsmonopol müsste fallen, was hieße, so absurd das zunächst klingen mag, dass jeder auf dem freien Markt Geld anbieten kann und die Marktteilnehmer für sich entscheiden, mit welchem Geld sie ihre Geschäfte machen. Da würde sich ganz schnell die Spreu von Weizen trennen Und vielleicht nicht gleich, weil heute derzeit das Zinsnehmen als etwas selbstverständliches gilt, aber irgendwann würden diverse Marktteilnehmer entdecken, dass ein Geld ohne Zinsnahme für beide Seiten auch seine Vorteile haben würde. Und die Idee, dass diejenigen, die Geld sparen würden und damit über die Banken Kapital anbieten, auf Konsum verzichten würden und dafür „entlohnt“ werden müssten, ist nichts weiter als Propaganda. Wer Geld spart, tut das, weil er für alle Fälle einen Notgroschen parat haben will oder weil er eine größere Anschaffung wie Auto oder Wohneigentum usw. tätigen will. Der Konsum wird nur verschoben und es wird mitnichten „verzichtet“.
Aber wie gesagt, ohne die Abschaffung der Ausbeutungsinstrumente Geld- und Zinsmonopol und Bodenmonopol ist diese Idee, die auf dem freien Willen der Marktteilnehmer beruhen würde, nicht zu realisieren.
Mir fehlt in diesem Bereich die Kompetenz um die Analysen von Herrn Krall vollständig zu erfassen, aber treffen die von Ihm getroffenen Probleme auch auf Firmen bzw. AGs zu die noch weitestgehend im Familienbesitz sind? Bei Henkel z.B. müsste das zutreffen. Bei BMW werden ja auch noch große Teile von der Familie Quandt gehalten.
Nein, dort gilt das für Gesellschaften im Familienbesitz nicht oder in viel geringerem Umfang. Deshalb agieren familiengeführte Unternehmen eben unternehmerischer. Sie sind ein Modell mit mehr Zukunft. Nicht das einzige, aber ein sehr gutes.
Das ist ja auch kein Wunder bei all den behördlichen und politischen und sonstigen gesellschaftlichen Bedenkenträgern (Gewerkschaften, Kirchen)! Schon etlichen der nach einem Obrigkeitsstaat a la Kaiserreich++ strebenden Unions-Anhänger passt vielfach (aus Neid?) nicht, dass jemand dank höherem Fleiss und höherer Intelligenz in Deutschland etwas aus eigener Kraft erreichen kann, ohne dank Parteibuch etc. einen Professorentitel erhalten zu haben.
Dazu hatte ich erst kürzlich längere Diskussionen mit einem langjährigen CDU-Mitglied. Deshalb ersinnen sie für alle neue Technologie (z.B. Gentechnik) für Gründer fast unerfüllbare Auflagen und wollen sogar alle uralte Technologie (z.B. Verwendung von Oxidationsmitteln, Säuren und Metallen sowie organische Chemikalien) unter diesem oder jenem Vorwand unter eine extrem teure Erlaubnispflicht forte stellen. Zugleich wurden zuvor bereits reihenweise hochintelligente junge Leute (ohne Parteibuch) auf verschiedenen Ebenen kaltgestellt: z.B. ein sehr begabter Nachwuchsphysiker, der schon am Gymnasium us unerfindlichen Gründen (Sportnoten?) kein Abitur erhielt und heute für Supermarktkassiererinnen im Supermarkt verschüttete Flüssigkeiten aufwischen darf (während sein Bruder an einer Elite-Uni in Physik promoviert hat) oder
ein ehem. Jugend-Forscht-Sieger Physik, der nach 10 Jahren eifriger Doktorarbeit um die Promotion gebracht wurde. Und denen, die zumindest noch promovieren konnten, droht nun die präventive Kaltstellung durch z.B. neue EU-Verordnungen.
Die Aussagen des Artikels finde ich nun doch etwas zu allgemein. Auch Familienunternehmen können in der Rechtsform einer AG organisiert werden, denn
auch die Rechtsform einer AG oder KGaA stehen mittelständischen Unternehmen offen und besitzen selbst für kleine Mittelständler ggf. einige Vorteile.
Das erforderliche Stammkapital erreicht man schliesslich sogar als kleiner Gründer relativ schnell, zumal eine teilweise Einzahlung wie bei einer GmbH inzwischen scheinbar ausreicht und bei der AG nur noch ein Gründer benötigt wird.
Grosse Mittelständler wie Henkel oder Merck nutzen diese Rechtsformen natürlich bereits seit zig Jahrzehnten.
Insofern dürfte die Unterscheidung nicht nach der Rechtsform getroffen werden, sondern zwischen Grossunternehmen mit angestellten Managern einerseits und Familienunternehmen andererseits!
Interessant geschrieben; allerdings gilt das vielleicht nur für die USA. Warum vergleicht der Autor nicht die größte dt. Untermehmen? Weil sich dann nämlich heraussteölt, dass es ift die gleichen sind. Nur in den USA überdauern Firmen nicht. Interessant in dem Zusammenhang das Buch „Enduring success“. Es geht um die Erfolgsgeheimnisse von Unternehmen >200.
Deutsche Bank – 2 Mrd. Boni – Echte Kapitalisten würden die Chefs mit Aktienoptionen bezahlen, die die erst 5/10 Jahre einlösen dürfen – beleihen o.ä. verboten. Boni erst, wenn der Gewinn wirklich realisiert ist.
Mit ETFs ist das Thema „Chef“ ja auch durch, einzig fähige Fondmanager sehe ich als Lösung, um bei Firmen was zu bewirken.
Und das der Staat keine Lösung ist, sieht man beim „VEB Volkswagen“, Gewerkschaften & Land Niedersachsen haben die Mehrheit – es hat überhaupt nichts gebracht. Im Zweifel sollte man da lieber auf BMW & Quandt Sippe setzen.
@Markus Krall: Danke für ihre Bücher und sehr klaren Worte.
Die Aktiengesellschaft entstand im 19. Jahrhundert, um Unternehmern (zunächst!) den Zugang zu privatem Kapital (letztlich ist alles Kapital privat, denn der Staat besitzt keins, er kassiert nur Steuern ein) ohne das Bankensystem und deren Pförtner- und Prüffunktion zu ermöglichen. Anders wären die ungemein kapitalintensiven Unternehmungen, wie der Bau der Eisenbahnnetze, oder, in der ersten Phase der Globalisierung vor 1914, der Aufbau gewaltiger Dampfschiff-Handelsflotten, nie finanzierbar gewesen. Too big to fail gab es auch damals übrigens schon, so die Verstaatlichung des deutschen Eisenbahnwesens ab ca. 1860. Denn Preußens Generäle, den amerikanischen Bürgerkrieg studierend, erkannten früh die militärstrategische Bedeutung der Eisenbahn. Da kam es ihnen sehr zupaß, daß der Kapitalmarkt für Eisenbahngesellschaften sich zu einer Blase entwickelt hatte, die zu platzen drohte, und so kam er Staat „zu Hilfe“. An den Folgen leidet die deutsche Eisenbahn bis heute. Bahnlinien entstanden in erster Linie nicht mehr da, wo die Kunden sie brauchten, sondern wo das Militär, aka der Staat, das für richtig hielt. Ein besonders markantes Beispiel die Wetzlarer „Kanonenbahn“, eine Strecke an allem größeren Städten vorbei durch die märkische und kurhessische Taiga, aufwendig gebaut, um im Falle eines Krieges mit Frankreich schnell preußische Truppen an den Rhein schaffen zu können. Das entscheidende dabei: Als es dann wirklich zum Krieg kam, 1914, stellte sich heraus, daß die Kanonenbahn eine völlige Fehlinvestition war, denn Moltke ließ die deutschen Armeen nach Belgien einmarschieren, und nicht wie gedacht nach Lothringen.
Die Habsburger Militärs im Wiener Generalstab verblieben mental dagegen im 19. Jahrhundert, so bekamen sie ihre Truppen nicht rechtzeitig nach Böhmen und bei Königgrätz wurde die Koalition des Rheinbundes zusammengeschossen, weil Moltke seine Truppen schneller verschieben konnte. Als Folge stieg nach 1866 der Parvenü Berlin und nicht die alte Kaiserstadt Frankfurt am Main zur Millionenmetropole und Hauptstadt der Deutschen auf. Aber hat es den Deutschen langfristig genutzt? Der Vergleich von Wien und Berlin heute mag Hinweise liefern.
2008 war der Kontext ein anderer, die Gründe sind aber im Grunde gut zu vergleichen.
Nachdem in den 1970ern die Deindustrialisierung der westlichen Staaten begann, folgte der Aufstieg der Investmentbanken, mit denen die zuvor ausgebooteten Banken zurück ins Spiel um die Billionen kamen. Nicht von ungefähr markiert, Deutschland betrachtet, diese Zeit auch das Entstehen der „Deutschland AG“ in der alten BRD, geführt von der Deutschen Bank, die, nachdem ihr der deutsche Markt zu klein wurde und Reagan und Thatcher die angelsächsischen Märkte und Finanzplätze liberalisierten, sich nicht nur internationalisierte, sondern von einer Kapitalbank für die deutsche Wirtschaft zu einem Selbstbedienungsladen für internationale Zocker zwischen Wall Street und der City umwandelte. Seitdem sind Aktiengesellschaften so, wie es Herr Krall beschreibt, seitdem haben wir „Shareholder Value“ und Quartalsdenken und Manager, die 50 Millionen im Jahr verdienen, oder 250.
Am Eigentum an sich liegt es nicht, denn auch Rentenfonds und Heuschrecken a la Soros oder Buffet oder Blackstone sind Eigentümer, die kein Geld verlieren wollen. Scheitern läßt sie die Aufhebung der Beziehung von Verantwortung und Handeln.
Überall, wo dieses Prinzip eingeführt wird, besonders augenfällig in der Politik, scheitern Systeme. Was dazu führt, und wie man das angehen kann, kann man nicht in einer Leserkommentarspalte abhandeln, aber Herrn Kralls Beitrag ist sicher erhellend.
Marktwirtschaft ist eben „kreative Zerstörung“…
Wer sein Land hasst und schnellstens abschaffen will, der wird auch die eigene Wirtschaft nicht stützen oder schützen. Das betrifft nicht nur grüne Phantasten, sondern auch linke Ideologen usw., die dem Klassenkampf frönen. Das Schizophrene ist nur, das all diese Politiker natürlich liebend gern alimentiert werden wollen und in vielen Fällen mangels eigener Wirtschaftserfahrung auch müssen. Damit schließt sich der Kreis, der letztlich und unweigerlich Zerfall und Untergang einer Wirtschaftsnation bedeutet.
Wer zahlt die Zeche ? Die Konsumenten, die Mitarbeiter, der Staat und oft auch die Händler der Produkte einer AG.
Festzuhalten: Es ist also nicht a priori der Staat mit seiner Bürokratie, der Unternehmen kaputt macht.
Da es bei Aktiengesellschaften letztlich um Kapitalismus versus Eigentümerverantwortung geht, darf man, den Artikel folgerichtig extrapoliert, den Kapitalismus selber als Ursachenbeteiligten für die langfristige Zerstörung von Unternehmen betrachten.
Interessant wäre die Übertragung der Systemgedanken auf die Politik. Auch hier sind Personen in „Verantwortung“, die jedesmal nur für ein paar Jahre gewählt sind, denen das Land nicht gehört, die auch nie persönlich Folgen für Versagen tragen müssen. Im schlimmsten Fall werden sie nicht wiedergewählt. Mit ihrem Vermögen haften sie nicht.
Würde man die verantwortungsrelevante Eigentümerphilosophie auf die Politik übertragen, müsste man zur Monarchie übergehen. Denn der einzelne Wähler in der Demokratie muss zwar die Folgen tragen, ist aber kein bestimmender Manager. Er gleicht unfreiwillig eher dem Aktionär und hat auch sonst kaum Unternehmens-Knowhow.
@Herbert Wolkenspalter
Hallo geschätzter Herbert Wolkenspalter,
einige Gedanken.
1. Nur das unbedeutende Fußvolk in denParteien und Parlamenten agiert auf Zeit.
Die Macher sind immer über die Liste gesichert.
2. Wir haben doch schon längst den Finanzfeudalismus. Die Politiker in der repräsentativen Demokratie sind nur Herolde der aus zuführenden Entscheidungen.
Damit den Knechten(alle Andern) der Anschein einer Mitentscheidung vorgegaukelt werden kann, Spielen die Parteien ein Schauspiel, in dem im Kasperletheater die wesentlichen Entscheidung, die Macht der Feudalherrn gefährdende Entscheidungen aus gespart werden.
Damit das nicht auffällt, streiten und lärmen die lustigen Püppchen heftig über unbedeutende Themen wie z.B. 10 EURO Kindergelderhöhung Monate lang untereinander, während eine Bankenrettung, Kriegseinsätze, EURO-Einführung, Migration über Nacht durch durchgepeitscht werden.
Da ist es doch unfair die Püppchen persönlich verantwortlich zu machen, oder?
@Hans Druchschnitt. Die Politiker müssen immer wieder gewählt werden aber auch innerparteilich den Posten zumindest halten, müssen dem Volk zwecks Wahlergebnis einfache Erklärungen liefern und dann auch so unzureichend umsetzen. Dafür stecken sie eine Menge Zeit und Energie rein, die für Besseres fehlt bzw. sogar verhindert.
Aber der Wähler hat sie halt gewählt.
Bei Mittelständlern ist es der Staat. Ich hatte Gelegenheit, am Freitag die übrigen Wohnräume eines ehem. Fabrikanten mit einst über 100 Mitarbeitern zu
betreten, dessen Fabrik zur Zeit der französischen Revolution gegründet worden war. Ich war tief erschüttert, wie dringend renovierungsbedürftig die Räume zum Teil waren, obwohl selbige Familie just Unsummen an Steuern und
Strassenbauabgaben zahlen musste, wovon man die Wohnung leicht 10 Mal hätte aufwendig renovieren können. So würde man keinen Flüchtling wagen, unterzubringen, denn da blühte schon Schimmel an ein paar Stellen an der Wand! In unserem Ort wurden Flüchtlingswohnungen zuvor per Schimmel-Spürhund untersucht, obwohl sie zuvor gross renoviert worden waren.
Man muss nämlich mal die Steuersätze vergleichen: Mittelständler zahlen z.T. schon ab dem ersten Euro Spitzensteuersatz von einst bis zu 54.3% Einkommens-/Körperschaftsteuer, zuletzt 42% und nun wohl 45%! Findige internationale Konzerne und Grosskonzerne zahlen hingegen oft nur <=5% Steuersatz!
Das Geld, das sich der Staat einsteckt, fehlt dann im Unternehmen für Investitionen (und beim Einkommen des Unternehmers).
Unter Bürokratie (lesen, worauf man antwortet!) verstehe ich Auflagen, Dokumenationspflichen und ähnlich Lästiges mehr.
Große Unternehmen waren auch mal klein. Geht also trotz Staat. Besser andere Gründe suchen. Der konkurrierende Markt selber macht am meisten zu schaffen.
Wenn es nicht so traurig wäre, müsste ich jedes Jahr bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank schmunzeln. Die Gewinne bröckeln (vorsichtig formuliert, tatsächlich sind es eher Verluste), die Dividende ist daher auf einen (offenbar rechtlich unumgänglichen) Minimalwert reduziert. Nur eins steht von vorneherein fest: Ca. 2 Mrd. Boni (bei ca. 200 Mio. Euro Dividenden) für die entsprechenden führenden Angestellten. Leider drücken sich diese Boni nicht in Performance (Kurs) aus. Dort ist man eher auf dem Weg zum Pennystock.
Das Geschäftsmodell ist daher für mich klar: Alle paar Jahre wieder gibt es eine kräftige Kapitalerhöhung, und wenn das Geld durch Zahlung dieser ganzen Boni aufgebraucht ist, kommt die nächste Kapitalerhöhung.
@Wolfgang Wegener
In Bezug zu deutschen Finanz- und Wirtschaftskonzern habe ich folgende Überlegung zur Diskusion an zubieten:
Große Kapialsammelstellen wie BLACHROCK steuern über unübersichtliche Kapitalverflechtungen ganze Wirtschaftsbereiche z.B. Banken oder Chemikonzerne.
*Mit der richtigen Strategie ist es möglich von Verlust gefährdete Konzere( z.B. Monsanto) mit noch erfolgreichen Konzern (z.B.Bayer) zu vereinen, so den anstehenden Verlust von Mosanto in die Gewinn- und Lustrechnung von Bayer einzubinden, um dann über die befürchte Arbeitsplatzverluste- oder Verlagerungsdrohung noch leistungsfähige Staaten über Subventionen, Staatshilfen oder Steuereinbußen zu melken. Und die Kleinaktionäre über Dividendenverluste gleich mit.
Und wer kennt die Beteiligungsverhältnisse besser als der Hecht im Rotaugenteich;-))
Mit der Stratigie kann ich meine Großanleger zu Lasten der Kleinleger und Staaten vor Verlusten schützen. Alles nur eine Frage der Information und Macht über größtmögliche Verflechtung.
Das ist nun mal der Gang der Dinge. Alles ist irgendwann überkommen. Schon unsere Vorfahren sagten, was die erste Generation aufbaut vergrößert die zweite Generation und die Dritte verschleudert es dann. Es mag nicht immer so schnell gehen, aber es ist etwas wahres daran. Warum sollte das bei AGs anders sein?
Es hat sich derzeit schlicht alles überlebt. Diverse AGs, unser Staatssystem, das Sozialsystem, alles kommt an seine Grenzen.
Wenn ich mir unsere Sprache, mit Worten wie „Denke“, „Schalte“ B2B etc. ansehe, dann kommen wir selbst dort an die Grenze.
Ein wahrer Satz… Manager sind keine Unternehmer!
Manager sind Buerokraten… Befehlsempfänger.. Zombie Führungskräfte…ohne Selbstbestimmung und Eigenverantwortung..ohne Herzblut und eigenes Risiko!
Danke Herr Krall, wie immer ein Super Artikel.
Diese Beobachtungen kann man Eins zu Eins auf die Landesverschenker und Bürokraten-, Selbstversorger Denke unserer Politiker übertragen. …..Ist doch nicht umein Eigentum, wen interessiert es wenn der Laden bankrott geht?