Die Aktionäre der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sollten «kein Club einer privilegierten Minderheit» sein, forderte Klaus J. Stöhlker an deren jüngster Generalversammlung. Als Redner gehört der Schweizer PR-Haudegen offensichtlich dazu, aber was will er uns damit sagen?
Dass die Schweizer Bevölkerung eigentlich noch reicher ist, als man eh schon wusste. Wie das? Zum Verständnis hilft ein kurzer Ausflug in die Geschichte. 1897 scheiterte der Versuch, eine reine Staatsbank zur Herausgeberin der einzig legalen Währung der Schweiz zu machen. In einem Referendum wurde das abgelehnt, es schloss sich ein zehnjähriges Ringen um die Art der Beteiligung des Volkes an. Das, wie anders, 1906 in einem Kompromiss endete. 1907 wurde eine Mischbank operativ, die gleichzeitig Staatsbank und Privatbank war und ist.
Es wurden 100.000 Aktien zu 250 Franken ausgegeben, für öffentlich rechtliche Eigentümer und für Private. Die SNB AG ist dabei eine «spezialgesetzliche Aktiengesellschaft». Damit wird geregelt, wer das Sagen hat und gleichzeitig wird die Dividende pro Aktie auf maximal 6 Prozent des Aktienwertes gedeckelt. Somit beträgt das Aktienkapital der SNB nominal 250 Millionen Franken; zu ihren grössten Aktionären gehören die Kantone Bern (6,6 Prozent), Zürich (5,2) und Theo Siegert aus Düsseldorf (5,2), alles per 31. 12. 2018.
Der Gründungsgesetzgeber wollte ausdrücklich eine Volksbeteiligung, was auch den direktdemokratischen Strukturen der Schweiz entspricht. Allerdings: Etwas mehr als 50.000 Aktien reichen natürlich hinten und vorne nicht, um aktuell rund 8 Millionen Schweizer an der SNB zu beteiligen. Das war auch so lange kein Thema, als die SNB die Notenbank eines armen, aber gesunden Völkchens von Hirten und Sennen war. Da gehörte es zum guten Ton einer «privilegierten Minderheit», mindestens eine SNB-Aktie zu halten. Und das Volk hatte ganz andere Probleme.
Das änderte sich, als nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers, nach der Finanzkrise von 2008, nach der Eurokrise und bis heute die SNB die Notenbank einer der stabilsten Währungen der Welt wurde. Einer so nachgefragten Währung, dass sie alleine im ersten Quartal dieses Jahres einen Gewinn von über 30 Milliarden Franken erwirtschaftete. Bei einer solchen Zahl können deutsche Finanzhäuser (und Schweizer) nur vor Neid zu sabbern beginnen. Die Deutsche Bundesbank hält rund 6 Milliarden Euro Eigenmittel vorrätig, auf schlappe 11 Milliarden Euro beläuft sich das Kapital der EZB.
Wem gehört denn nun dieser Gewinn der stinkreichen Schweizer Nationalbank? Ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres jeder Schweizer um 3.750 Franken reicher geworden? Sollte es nicht so sein, dass die Aktionäre mit ihrem Engagement in der SNB ihre Verbundenheit mit der Notenbank zum Ausdruck bringen, wie das der Bankratspräsident bei der Generalversammlung der SNB von 2018 so schön ausdrückte?
Allerdings gibt es da ein offenkundiges Problem. 8 Millionen potenziellen Aktionären stehen nur rund 50.000 Aktien gegenüber, obwohl das Regelwerk der Schweizer Börse SIX die Chancengleichheit des Kapitalmarkts unter Schutz stellt. Und dann gibt es noch ein nettes Detail bei der Bewertung der SNB.
Ausweislich ihrer Bilanz verfügt die SNB über ein Eigenkapital von 150 Milliarden Franken. Dem steht ein Börsenwert von aktuell rund 550 Millionen Franken gegenüber. Wobei die Aktie alleine seit Anfang 2019 von 4.000 auf ein Zwischenhoch von 6.000 Franken stieg. Wie ist ein dermassen krasses Missverhältnis zwischen Börsenkapitalisierung und innerem Wert möglich?
Werfen wir dafür kurz einen Blick in den konsolidierten Finanzbericht des Kantons Zürich, einer der grössten Aktionäre der Nationalbank. Der «anteilige Kapitalwert» der 5.200 SNB-Aktien im Besitz des Kantons wird richtig mit 6,3 Milliarden Franken angegeben (das sind 5,2 Prozent des SNB-Eigenkapitals per 31. 12. 2018). Aber dann wird das wegbilanziert, obwohl Zürich nach dem Buchlegungsstandard Swiss GAAP FER bilanziert, wo als oberste Richtschnur ein den tatsächlichen Vermögensverhältnissen widerspiegelndes Buchungsbild gilt. Und am Schluss steht dann der Nominalwert von 5.200 mal 250 Franken in der Bilanz.
Warum ist dann die SNB mit diesem Eigenkapital an der Börse 300 mal weniger wert? Die naheliegende Antwort: Das ist der Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist. Bedingt durch ein sehr eingeschränktes Mitbestimmungsrecht, eine gedeckelte Dividende, ein sehr kleines Handelsvolumen (kaum 200 gehandelte Aktien pro Tag). Und überhaupt: von einem Kauf wird in der gesamten Wirtschaftspresse abgeraten («risikoreiche Anlage», NZZamSonntag, «Finger weg von der SNB-Aktie», NZZ, «Spekulation: Die Nationalbank ist keine Bank», Handelszeitung, «Die SNB-Aktie ist ein gefährliches Kuriosum», Finanz & Wirtschaft), um nur einige Schlagzeilen zu nennen. Selbst die Gratis-Postille «20 Minuten» warnt ihre Leser: «Die SNB-Aktie ist jetzt ein Papier für Zocker».
Also ist es wirklich so, dass die SNB-Aktie nicht fürs Volk geeignet ist, nur von Zockern für spekulative Zwecke gehandelt wird? Schliesslich sollte doch der Preisregulierungsmechanismus (Wert/Bewertung + geringe Stückzahl) auch hier spielen.
Tut er aber nicht, nicht zuletzt, weil medial den Lesern der Ankauf der Aktien ausgeredet wird. Mit dem Argument, dass es halt nur 50.000 Stück gebe, also viel zu wenig für alle. Aber: Das Schweizer Volk muss sich als gewollter Investor bei der SNB nicht als Spekulant verunglimpfen lassen. Die Schweiz hat sich vom armen Auswanderungsland zu einem reichen, modernen Staat entwickelt. Das spiegelt sich im Eigenkapital der Notenbank wider. Da der hohe Nominalwert von 250 Franken ihrer Aktie nach Aktiengesetz bis auf 0,01 Franken gesplittet werden könnte, wäre so eine Volksbeteiligung problemlos möglich.
Sollen dadurch die Schweizer endgültig dazu motiviert werden, ein Volk von Spekulanten zu werden? Gemach, für Privataktionäre wurde die SNB nicht gegründet. Die meisten Medien erwecken aber den falschen Eindruck, dass sich der Börsenwert nach den Interessen der Privataktionäre, diesen Spekulanten, abstelle, und daher sei es gut, dass er so niedrig ist. Es soll hier keineswegs der Gewinnausschüttung oder Umverteilung des Eigenkapitals das Wort geredet werden. Das wäre auch gar nicht möglich. Aber ein Meinungskartell instrumentalisiert den für die SNB vollkommen unbedeutenden Privataktionär zur künstlichen Niedrigbewertung des öffentlichen Vermögens. Und das müsste die Öffentlichkeit hingegen sehr interessieren.
Denn wie kann es sein, dass ständig die Rede ist von der gewaltig aufgeblähten Bilanz der SNB, den Risiken ihrer Anlagen in fremden Währungen? Von ihren Interventionen am Devisenmarkt, von ihrer Negativzinspolitik? Aber niemals davon, dass sie nach dem Willen ihrer Gründer zur Hälfte dem Schweizer Volk gehören sollte? Und niemals davon, dass man mit ihrem Eigenkapital viel Gescheiteres anstellen könnte, als es wegzubilanzieren. Denn es handelt sich um Volksvermögen, was nicht bedeutet, es zur Hälfte auf das Volk zu verteilen. Aber es in den Dienst der Schweizer Bevölkerung zu stellen.

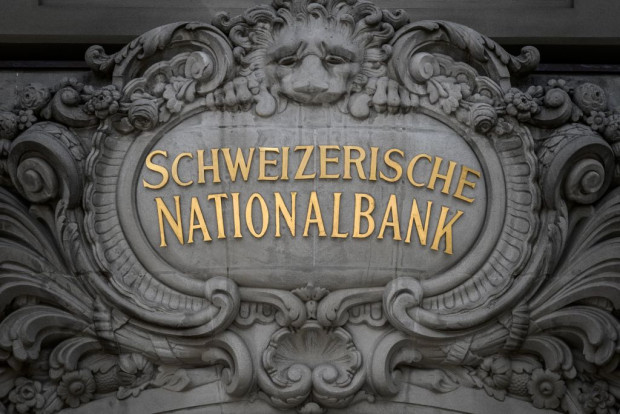
Akzeptanz der Notenbank durch Beteiligung in der Gesellschaft
Die EZB betreibt eine als Antideflationspolitik vermarktete Staatsfinanzierung.
Die SNB dagegen hat in diesem desaströsen Finanzmarktumfeld
den Tourismus und die Exportwirtschaft geschützt und zudem noch ein
Eigenkapital von Franken 150 Mrd. gebildet.
Dem stehen Anlagen in Euro und Dollar in Höhe von Franken 800 Mrd.
gegenüber.
Damit ist sie gegen einen 20 prozentigen Verfall dieser Anlagen geschützt.
Diese Anlagen sind hochliquide.
Die SNB wird als eine der ersten eine unumkehrbare internationale
Finanzmarktverschlechterung erkennen, die mutmasslich zu einem internationalen
Schuldenschnitt a la Zypern führen wird.
Da die Anlagen in Höhe von Franken 800 Mrd. hochliquide sind,
wird sie diese mutmasslich in einer untertägigen Überrraschungsoperation
glattstellen.
Der 15. Januar 2015 hat ihr überraschendes, entschiedenes Handeln
aufgezeigt, wenn sie dies für das Land für geboten erachtet.
Ein daraus resultierender Verlust von vielleicht 10 Prozent führt zu einem
Schaden von Franken 80 Mrd. .
Das Eigenkapital beträgt dann immer noch Franken 70 Mrd. ,
und sie hat den Export und den Tourismus geschützt.
Ganz im Gegensatz zu ihrer hohen Bedeutung für die Schweiz wird auf sie
unaufhörlich eingedroschen.
Das liegt vor allem daran, dass sie nicht – wie beabsichtigt – im Schweizer
Volk verankert ist.
Und zwar hinsichtlich der Informationen und der Beteiligung des
Volkes.
Doch genau das war gewollt.
Und weil das nicht praktiziert wird, wird die Notenbank als Fremdkörper
wahrgenommen, die undurchsichtige Geschäfte betreibt.
Würde die Notenbank , wie die Gründer es beabsichtigten,
dem Volk gehören, in der Weise, dass jeder eine Aktie hätte,
wäre das ihre Notenbank, jeder würde sich für sie interessieren,
sich mit ihr identifizieren, sie wäre in der Mitte der Gesellschaft verankert,
die Schulkinder würden bereits mit ihrer Notenbank aufwachsen,
was auch dringend geboten ist, angesichts der nahezu alles andere
überragenden Bedeutung ihrer Notenbank.
Das alles wäre ganz einfach durch einen Aktiensplit zu bewerkstelligen.
Jede Aktie hat nämlich einen sogenannten Nominalwert,
einen Nennwert, und dieser beträgt Franken 250.
Nach dem Aktiengesetz kann man bis auf einen Rappen heruntergehen.
Theoretisch liesse sich die jetzige Anzahl für das Volk von 50.000 Aktien
verfünfundzwanzigtausendfachen.
Für eine nicht so hohe, jedoch ausreichend angemessene Stückzahl wählt man
eben einen höheren Nennwert als einen Rappen.
Die direktdemokratischen Strukturen schon damals wollten die Beteiligung
des Volkes zu 40 Prozent.
40.000 Aktien von insgesamt 100.000 Aktien reichten damals aus,
da Land, Volk und Notenbank arm waren.
50.000 Aktien heute, von insgesamt immer nur noch 100.000 Aktien
reichen nicht, da Land, Volk und Notenbank reich sind.
Was den Wert der SNB angeht, ist das ganz einfach.
Ob gross oder klein, es ist wie bei einem Haus.
Man zeichne sich ein T.
Auf der linken Seite sind die Vermögenswerte,
auf der rechten Seite ist die Finanzierungsseite,
also wie das Vermögen auf der linken Seite finanziert ist.
Dafür kommen Eigen- und Fremdmittel in Frage.
Ein Haus von Franken 800.000 steht auf der linken Seite des T,
also der Bilanz.
Auf der rechten Seite hat der Hauseigentümer Franken 650.000
als Kredit,
und Franken 150.000 als eigene Mittel .
Der Hauseigentümer ist damit also gegen einen 20 prozentigen
Wertverfall seiner Immobilie geschützt.
Erst dann beginnt seine Verlustzone.
Die SNB hat Franken 800 Mrd. auf der linken Seite an Anlagen,
Franken 650 Mrd. als Fremdmittel
und Franken 150 Mrd. als
Eigenmittel auf der rechten.
Ihr Wert beträgt Franken 150 Mrd. und wird überall auch so
ausgewiesen, bei ihren Miteigentümern, den Kantonen,
in ihrer eigenen Bilanz, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung,
der Finanzstatistik der Schweiz, und nur an der Börse wird sie mit
Franken 500 Mio. bewertet.
Das liegt vor allem daran, das einige Medien ihren Lesern und dem
Volk die Aktien ausreden und negativ über die SNB berichten, statt
dem Volk ihre Notenbank mit Informationen näherzubringen,
weil es ihre Notenbank ist, die Notenbank, die dem Volk
gewidmet wurde, und, statt sich für eine Beteiligung für alle
einzusetzen.
So projizieren einige Medien Irrtümer und Missverständnisse
auf die Eigentümer, obwohl die Rechte bekannt sind, und das
Volk mit einem Engagement in die SNB seine Verbundenheit
zum Ausdruck bringen möchte.
Einige Medien erwecken den Eindruck, dass sich der Wert der SNB
nach den beschränkten Rechten der Privataktionäre bemisst.
Doch diese sind nur mitbeteiligt, und niemand hat sich damals
überlegt, ein paar Tausend Privataktionäre an die Börse zu bringen.
An die Börse gebracht wurde die Notenbank, und das Volk mit dabei.
Man stelle sich nur eine einzige verbliebene Aktie in der Hand eines
Aktionärs vor, und der Wert der ganzen SNB soll sich nach dem
Wert dieser einen Aktie für diesen einen Aktionär bemessen.
Noch dazu qualifizieren einige Medien die Eigentümer als Spekulanten ab,
obwohl die Eigentümer dem Gründungsgedanken nach Volksbeteiligung
entsprechen.
Das muss sich weder deren Leserschaft noch das Volk gefallen lassen.
Durch Wissen und Beteiligung an der Notenbank kann diese
Institution, die von so überragender Bedeutung für das Land ist,
in der Gesellschaft verwurzelt werden.
Ich verstehe wirklich nichts von Währungen und Nationalbanken, erst recht nicht vom Franken und der SNB und sollte mich daher des Kommentierens hier enthalten.
Mir lässt nur keine Ruhe, dass die im Vergleich „kleine“ SNB eine etwa hundertfache Eigenkapitaleinlage wie die EZB halten soll, wenn ich das dem Artikel korrekt entnommen habe.
Ich stelle mir vor diesem Hintergrund die unglaubliche Hybris der EZB Banker um Draghi vor, wie sie, getrieben von ihrem keynesianischen Interventionismus, in den letzten Jahren, ich glaube für um die 60 Mrd. € je Monat, ihr wahnwitziges QE Programm zur Durchsetzung einer ruinösen Null-Zins-Politik durchziehen, das nur durch die Notenpresse „gedeckt“ ist, wo im Gegensatz zu einer SNB nur heisse Luft dahinter steckt.
Bis jetzt soll sich diese QE Luftnummer der EZB wohl auf ca. 2.6 Bio. ( i.e. 2.6E+12) € aufgebläht haben. Und der Wahnsinn geht unverdrossen weiter, auch wenn die EZB Hasardeure sich inzwischen im „QE Phase-out“ befinden, in dem nur noch ca. 30 Mrd € je Monat, vor allem zulasten des deutschen Steuerzahler- und Sparer-Michels verbrannt werden.
Mir offenbart sich hier die gleiche Hybris und Allmachtphantasie, die reziprok zur vorhandenen Kompetenz und Fähigkeit vorherrschend zu sein scheint, wie bei den Klima-„Rettern“.
Aus gutem Grund wird davon abgeraten. 2/3 der Aktien ist in öffentlicher Hand (Kantonalbanken /Kantone). Ausschüttungen gehen an Bund / Kantone. Dividende ist beschränkt auf Max. 6% des Aktienkapitals bei ausschüttbarem Bilanzgewinn. SNB ist eine spezialrechtliche AG wie die Post, SBB.
Art. 99 der Bundesverfassung regelt:
„Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an die Kantone.“
Zuerst informieren, dann lamentieren. Inzwischen ist die Mehrheit der Aktien in privater Hand. Die Limitierung der Dividende und die Tatsache, dass es eine spezialrechtliche AG ist, steht im Artikel. Es wird im Chor und grundlos von einem Kauf abgeraten. Und gegen den erklärten Willen bei der Gründung der SNB als staatlich-private Notenbank. Abgesehen davon, dass zumindest ich kein sichereres Investment in eine Aktie kenne: Das Hauptargument des Artikels ist, wieso mit dem gigantischen EK nicht etwas Sinnvolleres angestellt wird als es blöd rumliegen zu lassen. Und warum durch einen Aktiensplit die ursprüngliche Absicht, dass die Schweizer Bevölkerung an der SNB beteiligt sein soll, nicht eingelöst wird.
Dividende / Aktie von Max. 15CHF ist ein gutes Investment? 6% von 25Mio chf für 100‘000 Aktien. (https://www.snb.ch/de/ifor/shares)
Auch wenn sie kotiert ist, kann sie kaum verklagt werden (Österreicher versuchte es).
Mir Unformiertheit vorzuwerfen, ist vielleicht nicht ganz angebracht.
Halte zu Gnaden: wenn Sie einleitend schreiben, dass sich 2/3 der SNB-Aktien in öffentlicher Hand befänden, dann sind Sie uninformiert. Die max. 6 Prozent vom Nominalwert gelten nur für Privatanleger, nicht für staatlich gehaltene Aktien. Aber die Gewinnverteilung und Ausschüttung ist gar nicht mein Punkt, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, und wer eine SNB-Aktie kauft, weiss das oder sollte es wissen. Aber abgesehen davon, dass im heutigen Nullzinsumfeld diese Dividende nicht ganz schlecht ist, gibt es bei einer Investition – neben dem Ertrag – auch den Wert der Sicherheit, nicht wahr.
Ich bin immer wieder über ihre Artikel überrascht. Wenn ich mir den Geldzuwachs und das Portfolio der Frendwährungen Euro und Dollar ansehe die seit 2008 in der SNB Kasse schlummern bekomme ich es mit der Angst zu tun. Herr Hildebrandt, der Spezl von Larry Fink BLACKROCK hat die SNB durch die völlig nutzlose Koppelung an der Euro zu einer Hochrisiko Bank gemacht. Jahrzehntelang lagen die Auslanddevisen auf ziemlich niedrigen Niveau. Erst als er an die Macht „gesetzt“ wurde stiegen diese Devisen gefährlich an.
Ich vermute ein bewusstes Handeln dahinter um die Schweiz in die EU zu tricksen. Platz der Euro ist der Franken auch hinüber.
Nichts gegen Verschwörungstheorien. Aber die Amtsausübung von Hildebrand und das Anschwellen der Bilanz der SNB ist reine Koinzidenz. Man darf hier Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Nicht der Franken ist das Problem, sondern der Euro. Das ist nicht einfach eine Frage der Perspektive. Die SNB musste damit umgehen, dass die Währung des Gebiets, in das die meisten Exporte gehen, kränkelt. Da ist guter Rat teuer; was immer die SNB macht, kann falsch sein. Ohne Untergrenze wäre der Franken womöglich zum Euro durch die Decke gegangen. Mit Untergrenze musste die SNB Multimilliarden Euro zur Stützung kaufen. Platzt der Euro, hat der Franken ein gröberes Problem. Aber Euroland ist dann abgebrannt und hat ein Riesenproblem.
Ein Kuriosum der besonderen Art, was aber nichts daran ändert, dass schweizer Aktien eine solide Geldanlage sind.
Vor allem ein Tip für Euroskeptiker. Meine Favoriten sind Nestle, Novartis, Roche und Swiss Prime Site.