TE – Josef Kraus: Herr Hardinghaus, die Generation, die den Zweiten Weltkrieg er- und überlebt hat und heute noch unter uns ist, lässt Sie nicht los. Nach Ihrem Buch „Die verdammte Generation“ vom Frühjahr 2020 über die letzten noch lebenden Wehrmachtssoldaten widmen Sie sich jetzt, gerade eben ein rundes halbes Jahr später unter dem Titel „Die verratene Generation“ den letzten Zeitzeuginnen des Weltkrieges. Fangen wir ganz praktisch und trocken statistisch an: Wie viele Frauen haben Sie für Interviews gefunden? Wie alt sind sie heute, wie alt waren sie im letzten Kriegsjahr? Wo in Deutschland leben sie heute? Allein, bei wem? Wie haben Sie Ihre Gesprächspartnerinnen gefunden?
Hardinghaus: So trocken und statistisch ist das gar nicht, denn ich erinnere mich auch emotional an jedes einzelne Gespräch ganz genau. Insgesamt habe ich 23 Frauen persönlich getroffen, mindestens ein Dutzend weitere telefonisch interviewt. Am Ende konnte ich die Erzählungen und Berichte von 13 Frauen ins Buch aufnehmen. Aus Platzgründen konnte ich nicht alle aufschreiben, aber ich brauchte alle Geschichten, um diese Generation zu verstehen. Bis auf zwei Ausnahmen waren die Frauen am Ende des Krieges zwischen 16 und 25 Jahren alt, also im jungen Erwachsenenalter. Jede hat in irgendeiner Form „Kriegsdienst“ geleistet, denn für Frauen in diesem Alter war das vorgesehen. Sie waren Schwestern im Lazarett, Helferinnen bei der Wehrmacht, Maiden im Kriegshilfsdienst oder sogar im Volkssturm.
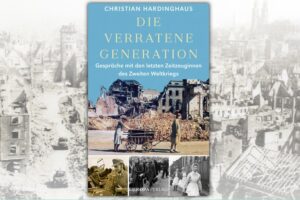
Hardinghaus widmet sich Frauen am Ende des II. Weltkrieges
TE: Warum ist es eine „verratene“ Generation?
Hardinghaus: Der Generationenbegriff, den ich für die Kriegsfrauen gewählt habe, passt in doppelter Hinsicht. Als junge Frauen sind sie schon von den Nazis verraten worden. Man hat ihnen vorgegaukelt, ein wichtiger Teil eines neuen, großen und friedlichen Deutschlands zu sein. Am Ende lagen sie misshandelt, vergewaltigt, ihrer Heimat und ihrer Habseligkeiten beraubt in Trümmerhaufen. Die Generation fühlte sich später aber auch verraten von ihren eigenen Kindern und Enkeln, die in ihnen immer nur die Täterinnen oder zumindest Mitwisserinnen sehen wollten. Es gibt so gut wie kein Buch über die deutsche Frau im Zweiten Weltkrieg, dabei wurden nahezu alle zu Kriegstätigkeiten gezwungen oder verleitet. Die wenigen Bücher, die sich mit der Rolle der Frau im NS-Staat befassen, beschreiben die Kriegsfrauen nicht als Opfer von Vertreibungsverbrechen und alliierten Flächenbombardements, sondern suchen nach Schuld und Mittäterschaft. Während die Geschichtswissenschaft kaum nach ihnen fragt, werden sie in der Frauen- und Geschlechterforschung höchstens als Opfer des männlichen deutschen Patriarchates in der NS-Zeit betrachtet. Das sind Versäumnisse und falsche Vorstellungen über viele Millionen unserer Vorfahren.
TE: Stehen Sie mit den Damen nach wie vor im Kontakt?
Hardinghaus: Absolut, ja. Diese Frauen haben ihr Schweigen gebrochen, einige hat es ganz bestimmt viel Überwindung gekostet. Jetzt, wo sie den Mut hatten, über alles zu reden, wollen sie natürlich auch erfahren, wie das Buch beziehungsweise ihre Lebensgeschichten aufgenommen werden. Fast jede hat sich nach Erscheinen erkundigt, manche rufen regelmäßig an oder schreiben sogar WhatsApp-Messages. Man teilt persönliche Geheimnisse, lernt sich kennen und es entsteht fast ein freundschaftliches Verhältnis. Ich werde jetzt auch keine alleine lassen und gebe das Feedback weiter. Sie sind Teil des Projektes. Sie sind die Protagonistinnen, von denen wir noch lernen sollen.
TE: Wie lange haben Sie jeweils mit den Damen gesprochen? Wie sind sie mit Ihnen umgegangen? Für wie authentisch halten Sie ihre Interviewpartnerinnen? Konnten Sie die Erzählungen gegenchecken, inwieweit hier Realität und Verklärung oder auch Verdrängung eine Rolle spielten?
Hardinghaus: Zeitzeugenbefragungen – oder auch Oral History – ist eine Methode der Geschichtswissenschaft. Der Historiker muss im Thema sein, sich eingearbeitet haben. Das ist ebenso eine Voraussetzung wie die persönliche Eignung, die Sensibilität verlangt. Wenn Zeitzeugen kein Vertrauen aufbauen können, erzählen sie nicht. Ist eine Basis hergestellt, kann man sich auf Augenhöhe unterhalten. Man darf sich die Kommunikation nicht als starres Interview vorstellen, eher wie ein langes Gespräch, bei dem die Zeitzeugin selbst bestimmt, was sie erinnert. Oftmals kommen ihnen selbst verdrängte Erinnerungen spontan hoch. Manchmal dauert es. Man trifft oder bespricht sich auch nicht nur einmal, sondern hält über längere Zeit Kontakt. Und wenn man das Gespräch aufgenommen hat, überprüft man als Historiker natürlich jeden Ort und seine Geschichte, checkt, ob es zeitliche Lücken oder Ungenauigkeiten gibt. Manchmal ist es ein stückweit Detektivarbeit – auch die Zeitzeuginnen können durch Recherche verschollen geglaubte Bekannte oder vermeintlich vergessene Orte wiederfinden. Es gibt schon ganz außergewöhnliche und spannende Zufälle.
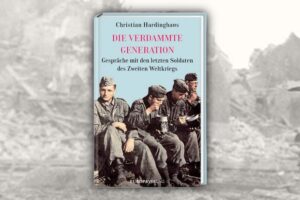
Historiker nähert sich den letzten Soldaten des Zweiten Weltkriegs
TE: Was war das Schrecklichste, was war das Glücklichste, was diese Frauen damals oder auch später erlebt haben?
Hardinghaus: In dieser Zeit sind so furchtbare und grausame Verbrechen geschehen, dass man das spontan nicht sagen kann. Es gibt aber Gemeinsamkeiten. Der Verlust geliebter Angehöriger zum Beispiel wirkt deutlich schwerer als eine eigene Misshandlung oder Vergewaltigung. Trauer ist das überwältigende Gefühl dieser Generation. Das betrifft ganz besonders die Vertriebenen, die sich nahezu alle bis heute nach ihrer verlorenen Heimat sehnen. Mit dem Kriegsende war jedenfalls das Leid dieser Generation lange nicht vorbei. Für die meisten war es der Tiefpunkt, an dem man alles verloren hatte und ganz neu anfangen musste. Allein, an fremden Orten, oft ohne Hilfe. Die glücklichsten Momente waren im Vergleich dazu ebenfalls die oftmals unverhofften Wiedersehen mit vermeintlich Totgeglaubten.
TE: Waren die Frauen damals in der NS- und Kriegszeit fasziniert von Hitler oder skeptisch oder kritisch? Wie sehen sie das Dritte Reich heute? Wie stehen sie zur deutschen Art und Weise, die Vergangenheit zu bewältigen?
Hardinghaus: Auch das ist unterschiedlich und stark abhängig von der Prägung im Elternhaus. Mehr noch als die männlichen Zeitzeugen haben die jungen Frauen damals auf das Wort ihrer Väter und Mütter gehört. Jedenfalls habe ich weder eine überzeugte Nationalsozialistin noch eine Widerstandskämpferin interviewt. Beides war im Vergleich auch eher selten. Alle Frauen, die ich interviewte, haben Unrecht gegen Juden und andere Minderheiten erlebt und waren nach eigenen Aussagen und nach Logik eines totalitären Staates nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Beim Bund Deutscher Mädel waren alle, die ersten freiwillig, später wurde es Pflicht und in der Regel gingen alle gerne hin. Es war für jede etwas dabei.
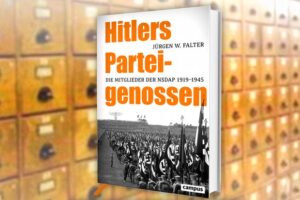
Eine bahnbrechende Studie zu den Mitgliedern der NSDAP
TE: Was gab und gibt diesen Frauen die Kraft, ihr Leben bis heute offenbar recht gesund und vigilant zu bewältigen?
Hardinghaus: Ich habe alle Zeitzeuginnen als charakterlich äußerst stark empfunden. Auch wenn sie ihre Altersleiden haben, so ließen sie sich das meist nicht anmerken oder nahmen sie tapfer hin. Diese Generation ist auch ausgezeichnet durch eine persönliche Bescheidenheit und Dankbarkeit an das Leben generell. Sie haben die Hölle gesehen und können daher sicherlich mit ihren Alltagsleiden besser umgehen als die Nachkriegsgenerationen, die keinen Krieg erleben mussten.
TE: Nicht alle der von Ihnen interviewten Frauen waren „Trümmerfrauen“ – allein schon wegen ihres damals noch kindlichen oder jugendlichen Alters. Aber alle haben wohl mitbekommen, wie gewisse Historiker und sogar führende Politikerinnen, etwa der Grünen, die Trümmerfrauen verunglimpften. Wie gehen die älteren Damen damit um?
Hardinghaus: Den Begriff Trümmerfrau sollte man meines Erachtens nicht allein für die zigtausend Frauen benutzen, die tatsächlich jahrelang Trümmer beseitigt haben. Er trifft auf alle zu. Eine ganze Generation lag in Trümmern. Ob Steinepicken, Schuttkippen oder Munitionsräumkommando: jede tat irgendetwas. Das blieb gar nicht aus, denn 16 Millionen Männer im arbeitsfähigen Alter waren tot oder in Gefangenschaft. Die Frauen wurden zu Meisterinnen ihres Alltags, weil sie überleben wollten. Sie mussten die Familie versorgen und hart arbeiten – ob in Trümmern oder anderswo. Für niemanden war es leicht.
TE: Wären die Frauen Geschichtslehrerinnen, wie würden sie den heutigen Geschichtsunterricht bewerten bzw. anders gestalten?
Hardinghaus: Im Grunde sehen sich alle Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, mit denen ich zu tun hatte, nicht richtig wiedergegeben im Schulunterricht, auch nicht in den Medien – und daher fühlen sie sich unverstanden. Die Erinnerungskultur in Deutschland ist sehr stark konzentriert auf eine entweder Täter- oder Opferperspektive. Für Alltagsgeschichte, Militärgeschichte oder Regionalgeschichte bleibt im Unterricht keine Zeit.
Besonders tragisch ist wohl, dass wir die ehemalige Heimat von 14 Millionen Vertriebenen einfach beiseitegeschoben haben. Die Kinder in der Schule können nichts mit Ostpreußen, Schlesien oder dem Sudetenland anfangen, das sind völlig fremde Begriffe. Auf der anderen Seite können sie sich aber auch nicht vorstellen, wie ein von Bomben entfachter Feuersturm in deutschen Städten gewütet hat, wie viele Frauen und Kinder darin verbrannt sind. Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlte, als hilflose Frau – von Tieffliegern gejagt – beschossen zu werden oder vor russischen Panzern wegzulaufen.TE: Haben Sie den Eindruck, Ihre Gesprächspartnerinnen wurden gebrochene Persönlichkeiten oder selbstbewusste Frauen oder auch zu Feministinnen? Was halten die Damen von den Verrenkungen der sogenannten geschlechtergerechten Sprache?
Hardinghaus: Die NS-Ideologie hatte eigentlich für die Frauen etwas ganz anderes vorgesehen. Danach sollten sie auf ihre Rolle der Gebärenden, Mutter und Erzieherin beschränkt bleiben. Viele Berufe, vor allem aber harte Arbeit, waren für sie nicht vorgesehen. Mit dem Beginn der Kriegsvorbereitungen ab spätestens 1937 mussten die Nazis aber ihre eigene Ideologie fallenlassen. Sie brauchten starke, selbstbewusste Frauen, um den Krieg am Laufen zu halten. Frauen erledigten all das, wo der Mann fehlte, weil er an der Front war – und sie waren teilweise selbst an der Front und bedienten Waffen. Auch das wäre vor dem Krieg nach Nazi-Ideologie absolut undenkbar gewesen. Ich glaube durch die Verantwortung, die die Frauen in Kriegslazaretten übernahmen, in den zerbombten Städten, wie sie die Fluchtrouten organisierten und koordinierten, ist die Emanzipation erst recht ins Rollen gekommen. Alle Frauen, mit denen ich geredet habe, haben beruflich etwas aus sich gemacht – sind Lehrerinnen, Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen geworden.
Themen wie geschlechtergerechte Sprache – das sind Probleme einer ganz jungen Generation. Die Aufregung um die korrekte Ansprache eines Geschlechtes können die Kriegsfrauen nicht nachvollziehen. Wenn man mit ihnen über diese Luxusprobleme redet und in die Gesichter schaut, weiß man genug: Unverständnis! Auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn ein gesprochenes Gendersternchen im Fernsehen hören sie nicht, für sie wird bei „Polizist*innen“ dann von weiblichen Beamten gesprochen und sie wundern sich, warum die männlichen Beamten nicht genannt werden. Man übergeht sie einfach in der Debatte darum.
TE: Wie war die erste Resonanz auf Ihr neues Buch? Bei den Beteiligten selbst? Im Buchhandel? Bei Buchbesprechungen? Gab es im Rundfunk oder Fernsehen Magazinbeiträge dazu und Interviews mit Ihnen? Gab es auch ideologisch motivierte Angriffe?
Hardinghaus: Viele Medien schreckt das Thema ab. Die Zeit, um differenziert über den Zweiten Weltkrieg zu berichten, fehlt noch an allen Ecken und Enden und Historiker wie Journalisten haben oftmals einfach Angst, in die rechte Ecke gestellt zu werden, wenn sie sich mit dem Leid der deutschen Bevölkerung beschäftigen. Das ist natürlich grundfalsch und obendrein gefährlich, denn unsere Vergangenheit hat viele Facetten und Perspektiven, die man zusammenbringen muss, um daraus Erklärungen für die Gegenwart und Prognosen für die Zukunft abzuleiten.
Mutige Redaktionen und Formate stellen sich dem Thema. Also ich schaffe es mittlerweile auch in Rundfunk und Fernsehen, ja. Die Anfragen häufen sich und die Bereitschaft, sich dem Thema anzunehmen, steigt, was mich sehr hoffnungsvoll stimmt. Natürlich gibt es in sozialen Netzwerken Menschen, die ideologisch so verblendet sind, dass sie resistent gegen die Wahrheit geworden sind. „Es gab keine Trümmerfrauen“, „Alle haben es gewusst“, „Alle (außer mir) sind schuld“ – Oftmals plappern sie immer die gleichen Phrasen rauf und runter und schicken mir die immer gleichen Artikel, ohne zu bemerken, dass ich all diese Dinge in meinen Büchern aufgreife und ausführlich bespreche – wenn nötig faktisch widerlege. Was eben zeigt, dass diese Sorte Kritiker mein Buch nicht gelesen hat. Die, die es haben, stellen sich den Fakten und da gibt es keine Anfeindungen, aber Einsicht und gar nicht selten sogar Entschuldigung an die eigene Elterngeneration.
TE: Menschen, die die Jahre um 1945 bewusst erlebt haben, lassen Sie nicht los. Gibt es schon ein neues, weiterführendes Projekt mit einer anderen Personengruppe?
Hardinghaus: In „Die verdammte Generation“ habe ich die letzten Soldaten des Zweiten Weltkrieges interviewt, in „Die verratene Generation“ die letzten heute noch lebenden Frauen. Konsequent wird mein nächstes Sachbuch die letzten Kinder und Jugendlichen des Zweiten Weltkrieges behandeln. Da stecke ich schon längst in hoch spannenden Interviews. Aber auch da rennt die Zeit.
TE: Danke für das Gespräch! Wir sind sehr gespannt auf dieses nächste Werk und helfen gerne wieder bei der Suche nach Zeitzeugen und bei der Verbreitung des Buches.
Christian Hardinghaus, Die verratene Generation. Der zweite Weltkrieg aus der Sicht der letzten Zeitzeuginnen. Europa Verlag, 336 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 20,00 €.


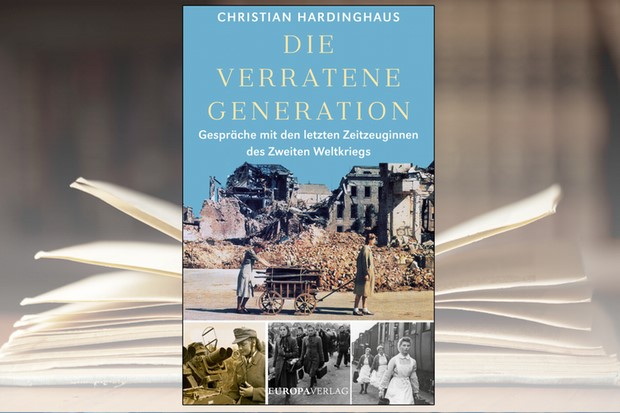
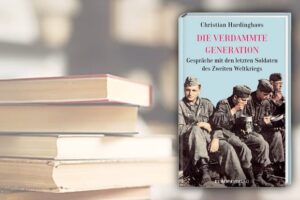
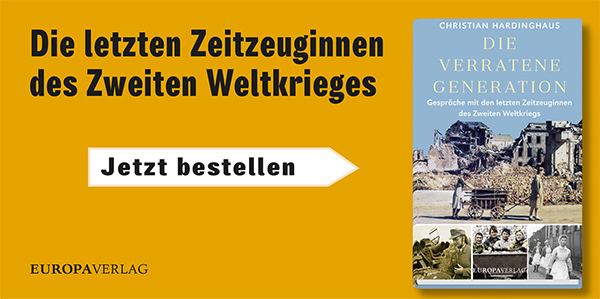
die hier Lebenden „hüpfen“ und „tanzen“ uns dahin zurück …
@Thorsten Stimmt. Das Traurige aber daran ist: Mit ihnen hüpfen auch deren Omas . Mit der Fahne: Omas gegen Rechts!
Das Buch wird wohl genau von denen NICHT gelesen werden, die es nötig hätten. Wenn ich mir die junge Generation so anschaue, mit Apfel-Smart-Phone, Edel-Jeans und Anspruchsdenken (und das auch bei „ärmeren Familien“…wobei „ARMUT“ heute für meine Eltern…als Kinder….der absolute Reichtum gewesen wäre) dann denke ich oft an die Generation meiner Großeltern und Eltern. Meine Mutter ist für 50 Pfennig AM TAG! mit den Bauern aufs Feld zum Distel-Stechen. Die Bauersleut saßen dann beim Mittagessen im Schatten bei Wurst und Speck und riefen meiner Mutter zu, sie solle doch nach Hause gehen….Ihre Leut hätten doch sicher das Essen auf dem Tisch. Für die 50 Pfennig gab es dann einen Strang Wolle, mit dem sich meine Mutter dann Unterwäsche strickte…tja…nur eine kleine Andekdote….und von denen gibt es unzählige. Die Generation Smart-Phone die nun die alte Generation die diese Land aufgebaut haben (ja die haben es aufgebaut und nicht die Gastarbeiter…die kamen anschließend als alles fast fertig war) in Pflegeheime abschieben und als lästige SUV-Umwelt-Nazi-Omas verhöhnen und beschimpfen…denen wünsche ich mal 1 Woche unter den Umständen unter denen meine Eltern groß geworden sind….nur 1 Woche!
„Die Generation fühlte sich später aber auch verraten von ihren eigenen Kindern und Enkeln, die in ihnen immer nur die Täterinnen oder zumindest Mitwisserinnen sehen wollten.“
Die Kinder- und Enkelgeneration ist bisher den Beweis schuldig geblieben, dass sie nicht auf Staats-(und NGO-)propaganda bzw eine ‚Gefälligkeitsdiktatur‘ (Götz Aly) hereinfällt. Das ‚großkotzige‘ Gehabe der jetzigen ‚jungen‘ Generation deutet darauf hin, dass auch diese glaubt, ihr könnte vergleichbares nicht passieren. Mal sehen, wie sie reagiert, wenn sie in 10 oder 20 Jahren erkennt, wie sie sich auf ein ‚totes Pferd‘ (Stichwort; Klimawandel, Rassismus, etc.) hat setzen lassen …
Aha. Jetzt sind sie also die „verratene“ der Generationen. Der Autor hatte vorher ja auch schon die „verdammte“. Warum nicht die „verlorene“, wie man praktisch alle nennt, die nach 60-65 geboren wurden? Okay, man hat aus PC-Gründen vor ca. 20 Jahren aufgehört, es lauthals zu erwähnen, was selbstverständlich genau gar nichts ändert…
Als Schluß bleibt nur, daß praktisch alle Generationen irgendwie verraten, verdammt oder verloren sind, bis auf eine natürlich: Die Heiligen, die Generation Gold, welche ca. zwischen 45-60 geboren wurde. Die, die uns heute wieder den Sozialismus inkl. der dazugehörigen Schweinereien bringen und die nicht nur die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern sie auch noch exklusiv gepachtet haben. Deren zu spät geborene Helfer können sich natürlich vom Makel der „Verlorenheit“ (oder was auch immer) reinwaschen, sofern sie nur kritiklos in Nibelungentreue den Ansagen der Goldenen Folge leisten…
Diese, diese eine auserwählte, heilige Generation, die sich selbst besser als alle anderen dünkt, ist genau die Generation, die weg kann. Auch die Arbeitswelt beweist mir das tagtäglich…
Daß es unter denen auch Ausnahmen gibt, brauche ich nicht erwähnen, denn das ist jedem denkenden Menschen sowieso klar. Und nur an diese wende ich mich. Alle anderen sollten besser die Sendung mit der Maus schauen, anstatt meine Texte zu lesen.
„Am Ende lagen sie misshandelt, vergewaltigt, ihrer Heimat und ihrer Habseligkeiten beraubt in Trümmerhaufen“ – das wird den heute lebenden Generationen natürlich alles nicht geschehen, sobald die Generation Gold mit ihnen fertig sein wird…
Die radikalsten Befürworter des Untergangs sind alle deutlich nach 1960 geboren worden, viele erst kurz vor der Jahrtausendwende.
ganz sicher ist das Buch interessant, obschon es nicht jedes Einzelschicksal behandeln kann. ME hat die Generation der Frauen, die
Die Kirche trug erhebliche Mitschuld an der Ächtung gerade dieser jungen Frauen, schließlich verbat sie die sexuelle Annäherung vor der (kirchlichen) Trauung.
Zur Nachkriegszeit kam noch der Verlust des Sparbuchs >Stichwort eisernes Sparen hinzu, und die Währungsreform, uvam.
Die erste Nachkriegsgeneration wuchs in Trümmern und Ärmlichkeit in äußerst beengtem Wohnraum auf, war genügsam, erfinderisch im Spiel und hatte Lebenswillen, war mutig und dankbar zB. für einen Kreisel, noch dazu, wenn er bunt angemalt war. Sie musste von kleinauf im Haushalt und in familiären Betrieben (zB Handwerk, Landwirtschaft) aktiv mithelfen, ohne Belohnung resp. Taschengeld. Tennis- und Hockeystunden, Klavierunterricht uvm war gar nicht möglich.
Es sind die Geborenen nach 1955, hier besonders jene, deren Elternhäuser ihnen mehr zu bieten hatte als ‚von der Hand in den Mund zu leben‘, die mit Eintritt ins Erwachsenenalter ihren Eltern Vorwürfe wegen der Schreckensherrschaft mit systematischem Judenmorden machten, die sodann eine politische Richtung einschlugen, um sich von ihren Vorfahren abzugrenzen. Fündig wird man besonders bei den Vertretern der Partei Die Grünen, die keinen Krieg erlebten und sich auch heute noch anmaßen, über ihre Vorfahren zu richten. Da diese größtenteils in hohem Alter sind – wenn nicht verstorben, werden Andersgesinnte gleichen Alters inflationär als Nazi (=Nationalsozialisten) beschimpft, wiederum, um sich imaginär selbst den Paß des Gutmenschen auszustellen.
Mein Eindruck ist jedoch, dass in ca. 10-15 Jahren ein großer Teil der bis dahin nachgewachsenen Generation (außer den indoktrinierten FFF-Girlies and Boys) genau diese sich heute als Gutmenschen empfindenden Deutschen infrage stellen wird, nach dem ja erkennbar ist, dass sie sich mit ihren Nazi-Keulen lediglich ein Wohlfühlbett mit Vollalimentierung des Staates geschaffen haben und Verrat am Kern der deutschen Historie ausüben.
Lieber Herr Kraus,
aus Gesprächen mit Zeitzeuginnen ist mir einige Erfahruungen ganz ähnlich bekannt. Bechuß durch Tieflueger, Verlust einer Freundin durch Bombenangriffe, Bombennächte in Kellern, schwierige Versorgungslage, immer wieder die Erinnerungen an die Flucht/Vertreibung und den Verlust der Heimat und das schwierige Leben nach Kriegsende.
Manchmal, wenn auch selten, verschämt und zurückhaltend, auch das Niederbrennen der Synagoge und das „Verschwinden“ der jüdischen Nachbarn in den Zeiten zuvor erwähnt. Und viel geschwiegen wurde über die Rolle oder Einstellung zum NS-Regime von Freunden oder Bekannten, das sollte man ebenfalls nicht vergessen.
vieles von dem war damals „Mainstream“. Und ein Aufbegehren endete an „Ostfront“ oder im „Lager“.
Damals war „Mithüpfen“ überlebenswichtig …
Gut dass es diese Bücher gibt. Von den ewigen Guten und Widerstandskämpfern haben wir genug erfahren und gehört. Von denen, die uns sagen wie es wirklich war und wie das Leben damals war hat man wenig bis gar nichts gehört. Die hatten alle keine Stimme.
Interessanter Artikel, und vielleicht ein interessantes Buch. Aber hier kann ich ganz und gar nicht folgen:
„Die Generation fühlte sich später aber auch verraten von ihren eigenen Kindern und Enkeln, die in ihnen immer nur die Täterinnen oder zumindest Mitwisserinnen sehen wollten.“ – Meine Mutter war Ende des Krieges 18, und weder in meiner Familie noch in irgendeiner Familie meiner Freunde habe ich annähernd diese Einstellung erlebt, nicht einmal entferntest. Während meines Studiums hat sich keiner meiner Kommilitonen so geäußert.
Meine Eltern waren Ende des Krieges beide 14 Jahre alt und waren bei meiner Geburt 21Jahre. Mir ist nie in den Sinn gekommen, sie als Täter zu sehen. Auch meine Großeltern habe ich nicht so gesehen. Aber viele meiner Klassenkameraden hatten nicht so junge Eltern wie ich, auch nicht so junge Großeltern. Diese Klassenkameraden haben sich in der beschriebenen Weise geäußert und verhalten. Auch viele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis damals.
Solche Vorwürfe konnte man schon vernehmen, sie kamen aus der Presse, sie waren Teil der „Aufarbeitung“ der Verbrechen des Nationalsozialismus. Meine Eltern haben haben über diese Zeit mit mir gesprochen, ich habe einsehen müssen, daß die Menschen sich in (unter gewissen Aspekten) recht ähnlicher Lage befanden, wie wir heute. Die Welt um sie herum änderte sich dramatisch, die Führung hatte viele, viele Anhänger, man schien machtlos zu sein und die meisten waren entweder dabei oder indifferent. Meine Eltern kamen allerdings beide vom Dorf, die Mutter aus Schlesien, der Vater aus Niedersachsen. Diese Generation hatte nichts zu entscheiden, was passiert war, gar nichts. Sie konnte nur die Folgen durchleiden und um das Überleben kämpfen, mein Vater als Soldat, meine Mutter als 21-jährige auf der Flucht vor der Roten Armee aus Schlesien, mit ihren drei jüngeren Schwestern und ihrer Mutter. Bruder und Vater waren gefallen. Mein Großvater hatte nach dem „Heldentod“ des Sohnes, von der Feldarbeit kommend, gewagt, die Parteifahne, die die Nationalsozialisten vor seinem Wirtshaus gehißt hatten, wo sie ihre Parteiversammlung abhielten, vom Mast zu holen, mit den Worten: „Nicht vor meinem Haus!“. Sehr schnell erhielt er dann den Stellungsbefehl zum Volkssturm, wo er alsbald umkam. Ich habe meine Eltern immer als Opfer dieser Zeit gesehen, niemals als Täter. Es war mir unheimlich, zu wissen, daß mein Vater, ein liebevoller, tierlieber Mann, mit eigenen Händen viele Menschen umgebracht hatte im Krieg. Es war aber klar, daß er sich das nicht ausgesucht hatte. Bis heute bewundere ich die innere Stärke, dieses Grauen zu überwinden und ein normales, tatkräftiges und erfolgreiches Leben danach zu führen, die meine Eltern bewiesen haben.
„Solche Vorwürfe konnte man schon vernehmen, sie kamen aus der Presse, sie waren Teil der „Aufarbeitung“ der Verbrechen des Nationalsozialismus.“ Richtig.
Aber der Interviewte geht viel weiter, er spricht nicht nur von „der Presse“. Er behauptet die beschriebenen Frauen seien „verraten von ihren eigenen Kindern und Enkeln, die in ihnen immer nur die Täterinnen oder zumindest Mitwisserinnen sehen wollten.“ Der Interviewte behauptet also: „immer nur“! Das scheint mir schlichtweg falsch.