Der Freihandel hat mächtige Gegner und derzeit wenig Freunde. Donald Trump ist dagegen, in Deutschland sind Grüne, Linke, linke Sozialdemokraten, Greenpeace und die AfD gegen Freihandelsabkommen wie TTIP. Als Argumente werden massive Gesundheitsgefährdungen durch die Absenkung deutscher Lebensmittelstandards, die Unterminierung demokratischer Prinzipien durch die Einführung privater Schiedsgerichte und ganz generell die Beschneidung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten ins Feld geführt (S. 150). Daher ist es verdienstvoll, dass Frank Schäffler und andere Autoren diesen Band herausgebracht haben, der sich sachlich mit dem Thema Freihandel und den zur Diskussion stehenden Freihandelsabkommen befasst.
Der Abbau von Zöllen und Handelsbeschränkungen, so Schäffler, hat mehr zur Bekämpfung der Armut auf dieser Welt beigetragen als sämtliche Entwicklungshilfe-Milliarden und alle Demonstrationen gegen die angeblich unmenschliche Globalisierung. In dem Band wird gezeigt, dass die Anhänger des Freihandels ursprünglich gerade im Interesse breiter Bevölkerungsschichten und besonders der Armen argumentierten – und gegen die nach Privilegien strebenden Vertreter einheimischer Industrie, die vom Protektionismus profitierten. Der wohl einflussreichste Freihandelsaktivist in der Geschichte war der Brite Richard Cobden (1804 – 1865), dessen Lebensweg in einem Beitrag nachgezeichnet wird. Cobden kam als viertes von elf Kindern eines armen Bauern zur Welt. Seine Mission war der Einsatz für den Freihandel, der Arbeiter und Arme vom Joch des Protektionismus befreite und erheblich zur Verbesserung der Lebensbedingungen für breite Schichten der Bevölkerung beitrug (S. 38).
Theorie des Freihandels
Fabian Kurz gibt einen Abriss über die Theorie des internationalen Handels. Freihandel ist vor allem deshalb nützlich, weil er die internationale Arbeitsteilung erleichtert. Denn die Grenzen der Arbeitsteilung liegen in der Größe des Marktes – je größer der Markt ist, desto mehr Menschen können miteinander kooperieren. Die immer präzisere Spezialisierung ist ein entscheidender Motor des Wachstums und Fortschritts. Schon Adam Smith zeigte, dass Freihandel den Markt vergrößert und damit mehr Arbeitsteilung ermöglicht (S. 65).
Schiedsgerichte sind wichtig
Der Freihandel hatte schon immer viele Gegner – hauptsächlich jene Zweige der Industrie, die vom Protektionismus profitierten. Nicht erst Donald Trump gefährdet den Freihandel, sondern schon Barack Obama verschärfte die „Buy American“-Klausel für das öffentliche Beschaffungswesen in den USA. Solange das Angebot eines amerikanischen Anbieters nicht 25 Prozent teurer als ein vergleichbares Wettbewerbsangebot ist, muss der amerikanische Anbieter den Zuschlag erhalten (S. 51).
TTIP- und Freihandelsgegner kritisierten vor allem die internationalen Schiedsgerichte. Deren Aufgabe ist es, Eigentümer vor dem willkürlichen Zugriff des Staates auf ihr Eigentum zu schützen. So klagte beispielsweise der schwedische Energiekonzern Vattenfall gegen das Land Hamburg. Es ging um ein Kohlekraftwerk, das der CDU-Senat 2005 bewilligt hatte, aber 2008 durch immer neue Auflagen einer grünen Umweltsenatorin verteuert wurde. Dagegen klagte Vattenfall auf Schadenersatz, schließlich kam es zu einer außergerichtlichen Einigung. Ohne diese Klagemöglichkeit wäre die Investition für Vattenfall unrentabel geworden. „Schiedsgerichte“, so Schäffler, „schaffen Rechtssicherheit für ausländische Investoren. Diese müssen sich nicht auf nationale Richter verlassen, die vom dortigen Staat bestellt und bezahlt werden.“ (S. 53) Gerade Schiedsgerichte sind ein großes Verdienst der Freihandelsbewegung. Sie begrenzen die Macht der Regierungen – was ganz im Sinne von Liberalen ist, aber natürlich nicht im Sinne von Etatisten.
Einer der interessantesten Beiträge des Bandes ist der von Julia Münzenmaier, die sich mit dem Investitionsrecht und internationaler Streitbeilegung befasst. Die Freihandelsabkommen schützen Investoren vor Risiken wie Enteignung, Diskriminierung ihrer Investition durch eine Begünstigung Dritter, fehlender Schutzgewährung bei Unruhen und Nichteinhaltung staatlicher Zusagen (S. 99). Direkte Enteignungen spielen heute nicht mehr eine so entscheidende Rolle wie früher, aber das Eigentum ist umso stärker gefährdet durch seine inhaltliche „Entleerung“. Das heißt: Der formale Rechtstitel des Privateigentums bleibt bestehen, wird jedoch durch zahlreiche Nutzungs- oder Verfügungsbeschränkungen ausgehöhlt (S. 102). Vor solchen faktischen Enteignungen – auch wenn diese nicht so genannt werden – sollen die in Freihandelsabkommen vorgesehenen Schiedsgerichte schützen. Die Angst vor einem damit einhergehendem Verlust des staatlichen Handlungsspielraums, so weist Münzenmaier nach, ist unbegründet. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Investoren im Vergleich zu früheren Investitionsabkommen nicht ausreichend geschützt werden (S. 106).
Für internationale ad-hoc-Schiedsgerichte spreche auch die Tatsache, dass Regierungen auf Entscheidungen von nationalen und staatlich bezahlten Richtern Einfluss nehmen könnten. „Diese Gefahr besteht nicht bei Richtern, die einer anderen Nationalität als derjenigen des im Verfahren beteiligten Staates angehören.“ (S. 107)
Bi- und Plurilaterale Handelsabkommen
Donald Trump ist bekanntlich ein großer Anhänger von bilateralen Handelsabkommen. Deren Zahl ist in den vergangenen Jahren ganz erheblich gestiegen, was – wie Jens Hertha in seinem Beitrag zeigt – erhebliche Risiken für den internationalen Handel mit sich bringt. Die Ausweitung regionaler Handelsabkommen sei sogar eine der Ursachen, weshalb in den letzten Jahren das weltweite Wachstum des Handels an Dynamik eingebüßt habe (S.79). Die Abkommen werden zunehmend komplexer, was einerseits mit steigenden Regulierungen auf nationaler und internationaler Ebene zusammenhängt, andererseits aber auch mit der zunehmenden Arbeitsteilung. Damit ein Zollbeamter weiß, welche Tarife für welches Produkt gelten, ist in allen Handelsabkommen festgelegt, was die tatsächliche Herkunft eines Produktes ist. Wie schwierig das ist, wird am Beispiel der Produkte von Apple deutlich, die in über 500 Fabriken in rund 30 Ländern gefertigt werden, bevor Endprodukte meist in China zusammengesetzt werden (S. 92).
Chlorhühnchen
Mit der Agitation und Propaganda der Freihandelsgegner setzen sich die beiden überaus lesenswerten letzten Beiträge des Bandes auseinander. Gesteuert wurden die Kampagnen vor allem von Grünen, Linken und einem NGO-Netzwerk gegen den Freihandel (S. 162 f.). Die Stiftungen der Grünen und der Linken haben mehrere Millionen Euro in europaweite Kampagnen gegen TTIP und CETA investiert. Parolen wie „TTIP tötet!“ und „TTIP ist eine Attacke auf unsere Demokratie“ fanden weite Verbreitung in den Medien (S. 163). Absurderweise werden viele NGOs, die sich gegen den Freihandel einsetzen, sogar von der EU-Kommission finanziert, die sich dafür ausspricht (S. 168).
So unterschiedlich die einzelnen Ablehnungspunkte sind, so einig sind sich Kritiker und Gegner in der Quintessenz, welche sich auf die Formel bringen lässt: „DIE Konzerne gegen UNS Bürger“. Dabei wird mit suggestiven Bildern gearbeitet, wie etwa dem vom „Chlorhühnchen“. Ein nacktes, gerupftes, totes Huhn ist ohnehin kein Anblick, der positive Empfindungen auslöst. Gepaart mit der Chemikalie „Chlor“, die in Deutschland vor allem Erinnerungen an Schwimmbäder oder aggressive Reinigungsprodukte weckt, entsteht ein furchteinflößendes Bild. Die hysterischen Kampagnen gegen TTIP speisen sich aus einer frei flottierenden Kapitalismuskritik, die sich heute am Freihandelsabkommen festmacht, morgen am angeblichen Klimagau und übermorgen am Verbrennungsmotor: Der Feind, nämlich der Kapitalismus und die „großen Konzerne“ bleibt dabei stets der Gleiche.
Zu Recht beklagen die Autoren die Schwäche der Freihandelsbefürworter, deren Wortmeldungen kaum vernehmbar oder unbeholfen waren. Dem Leser sei empfohlen, sich nicht durch einige für Laien teilweise schwerer verständliche ökonomischen Beiträge – etwa zum Thema „Außenbeitrag“ – abschrecken zu lassen. So verdienstvoll diese Beiträge auch sind, so sind diese eher an ein Fachpublikum gerichtet, während der größte Teil der Beiträge auch für eine breite Leserschaft interessant und verständlich ist. Das Buch wird eingefleischte Freihandelsgegner naturgemäß nicht erreichen oder überzeugen, aber es ist überaus wichtig, um den Befürwortern des Freihandels Argumente und Denkanstöße an die Hand zu geben. Bei einer Neuauflage des Bandes sollte noch ein Beitrag hinzugefügt werden, der am Beispiel Chinas zeigt, wie es Kapitalismus und Öffnung zum Weltmarkt ermöglicht haben, dass hunderte Millionen Chinesen von der Armut in die Mittelschicht aufstiegen. Wäre China heute nicht die zweitgrößte Exportnation der Welt, was wiederum eine Folge kapitalistischer Reformen und einer konsequenten Öffnung zur Weltwirtschaft war, würden immer noch Millionen Chinesen hungern, wie das zu Maos Zeiten der Fall war.
Frank Schäffler, Clemens Schneider, Florian A. Hartjen, Björn Urbansky, Freihandel für eine gerechtere Welt. Mehr als TTIP, Fracking und Chlorhünchen – ein Plädoyer für eine gemeinsame Welt, Edition Prometheus, FinanzBuch Verlag, München 2017, 167 Seiten.


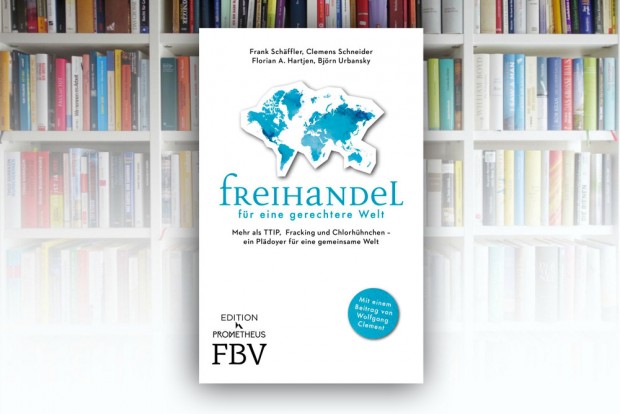
Grundsätzlich spricht nichts gegen freien Handel. Wenn man aber über Umweltverschmutzung, zu hohe Schadstoffemissionen und verdreckte Meere spricht, dann darf man schon mal getrost die Frage stellen, ob das was heute läuft nicht schädlich für die Menschheit ist.
Während man permanent die Automobilindustrie und den Autofahrer angreift und mit möglichst vielen Auflagen belegen möchte, interessiert sich heute niemand mehr für diejenigen, welche mit dem weltweiten Warentransport die wirklichen Auslöser der Probleme sind.
Ich halte die ganze Debatte für verlogen und wir sollten uns entscheiden was wir wollen, saubere Luft und Gewässer oder unbegrenzten freien Welthandel.
Die Freihändler haben seit Generationen den Fehler gemacht, dass sie nicht zu jeder Argumentation für die Freiheit immer auch ein Kapitel zu Verantwortung geschrieben haben. Der Markt gleicht nämlich die negativen Auswirkungen von Freihandel/Globalisierung nur dann sozial erträglich aus, wenn nachhaltig starkes Wirtschaftswachstum und nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Andernfalls entstehen ‚rust belts‘, und alles was in Europa, trotz teilweise besserer sozialer Abfederungen, ähnlich aussieht. Sollte, z.B. die Firma Siemens den 170 Jahre alten Standort Görlitz tatsächlich schliessen, und dafür irgendwo in den USA die Gasturbinenproduktion ausbauen, dann wird man in Görlitz, und darüberhinaus unter den Industriearbeitern und ihren Sympathisanten, wenige Globaisierungsfreunde finden. Freihandel/ Globalisierung haben auch vielen Unternehmen erst die Möglichkeiten zu teilweise sehr massiven Steuergestaltungen eröffnet, weshalb weder die Unternehmen, noch ein sehr grosser Teil der Aktionäre, nichts zu einem notwendigen produktiven, sozialen Umbau beitragen. Die sozio-ökonomisch untere Hälfte der westlichen Industriegesellschaften hat dann wenig bis nichts davon, wenn es einem Drittel der Chinesen und Inder deutlich besser geht, und die Preise für Ferienwohnungen/-häuser von Globalisierungsgewinnern (Sylt, Kitzbühel u.a.) auf € 20,000.- pro qm und mehr, steigen.
Sie haben recht, H. Zitelmann, die propagandistische Argumentation der TTIP Gegner ist unsachlich und teils kindisch.
Genau so unsachlich ist aber auch die Argumentation der Freihandelsbefürworter, wenn sie die systemischen Probleme des sogenannten Freihandels nach dem TTIP-Muster schön reden, indem sie einige wesentliche Aspekte gar nicht erst in ihre Argumentation einbeziehen. Hier mal kurz eine Auflistung der beliebten Nebelkerzen am Beispiel TTIP:
1. TTIP war / ist geplant als Freihandelszone zwischen den USA und der EU, mit dem vorgeblichen Ziel innerhalb der Freihandelszone alle Handelsbeschränkungen abzubauen. Es soll also ein größerer wirtschaftlicher Block geschaffen werden, um der „Gefahr“ aus dem Osten zu begegnen und international Maßstäbe zu setzen, also Normierung durchzusetzen. Das wird / wurde auch nie bestritten, widerspricht aber dem Gedanken des freien Handels im weltweiten Maßstab.
2. Es gibt ja schon das GATT. Eine Institution, die internationale Handelsdifferenzen zwischen Staaten im Verhandlungswege schlichten soll. Wofür benötigt man dann privatrechtliche Schiedsgerichte ? Die Antwort lautet. So wie die Schiedsgerichte im TTIP geplant waren, um die lästigen Vertreter der Staaten aus dem Schlichtungsprozess auszuschließen. Also die Schaffung einer supranationalen Institution ohne jegliche demokratische Legitimation, aber mit massivem Einfluss auf das Geschehen in den beteiligten Staaten. Die Tatsache, dass die Schiedsgerichte zunächst geheim verhandeln sollten, spricht Bände.
3. Apropos geheim. Warum wurden die TTIP-Verhandlungen mit höchster Geheimhaltung über die Inhalte geführt ? Vorgeblich um die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen nicht zu gefährden. Aufgrund der Indiskretionen erfuhr die Öffentlichkeit dann aber, dass es sich bei einem erheblichen Teil der Verhandlungen darum ging, den Kuchen schon mal zu verteilen. Was das mit freiem Handel zu tun hat wird wohl ewig das Geheimnis der TTIP-Befürworter bleiben.
4. Völlig unterschlagen wird bei der Diskussion, dass Staaten ja auch Konkurrenten um die besten Standortbedingungen sind und die Standortbedingungen ein Produktionsfaktor für die agierenden Unternehmen. Also das Prinzip der freien Marktkräfte erfüllen. Wenn man aber über diese Staaten ein privatrechtliches Mono- oder Oligopol wie TTIP stülpt, wird dieser Wettbewerb stark eingeschränkt, wenn nicht zum Erliegen gebracht. Der Effekt ist dann der, den man heute schon in vielen Branchen beobachten kann. Die großen Einheiten führen ihre Zulieferer am Nasenring durch die Arena, sprich diktieren deren Produktionsbedingungen ( gesetzliche Rahmenbedingungen ) und die Preise.
Insgesamt kann man also feststellen, dass zumindest TTIP nie ein Freihandelsabkommen im Wortsinn werden sollte, sondern das Mittel zur noch stärkeren Konzentration wirtschaftlicher Macht in privaten Händen, unter weitgehender Ausschaltung der Einflussmöglichkeiten der beteiligten Staaten.
Wenn man wirklichen freien Handel auf der Welt möchte, dann muss man diesen freien Handel auch zulassen, mit allem Für und Wider, wie wir das bei den massiven weltweiten Umwälzungen der industriellen Produktion in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das beinhaltet dann auch, dass man selber dabei unter die Räder des freien Marktes geraten kann, wie man ja in den USA und Europa eindrucksvoll bewundern kann. Dafür braucht es offensichtlich aber keine Freihandelsabkommen.
Ein „Freihandelsabkommen“ – bewusst mit Anführungszeichen – nach dem TTIP-Muster, ist also ein Betrug. weil es eben nicht den freien Handel fördert, sondern ein Kartell begründen soll(te), um dem weiteren wirtschaftlichen Machtverlust der USA und Europa entgegen zu wirken.
Wenn man so ein Kartell haben möchte, habe ich damit grundsätzlich kein Problem, wenn es demokratisch legitimiert ist und den Menschen die Folgen klar vor Augen hält. Dann sollte man es aber auch so nennen.
Wie wäre es mit TTT, „Transatlantic Trading Trust“.
Sehr geehrter Herr Zitelmann, als National-Liberaler sind Sie Pro – TTIP? TTIP war vor allem eine anti-demokratische Veranstaltungder EU zur Aushöhlung des deutschen Rechtsstaats (in der Art, wie entschieden werden sollte, in der Art, eine dubiose Paralleljustiz zu zementieren) Zudem sind Nationen wie die USA und andere mit ihrem riesigen Militärbudget verbal für Freihandel, aber im Inneren staats- und nationsorientiert. Der Militärhaushalt erscheint als Entwicklungsfinanzierung für nationale Vorteile zur anschließender Verwendung im Marktgeschehen zum Vorteil der eigenen nationalen Teilnehmer. Das ist auch Aufgabe eines Staats, der sich um seine EIGENEN Bürger kümmert. Über den mickrigen deutschen Militärhaushalt werden jedenfalls kaum Dinge angestoßen oder entwickelt, die strategisch den Wirtschaftsstandort Deutschland künftig sichern. Das machen die USA konsequent anders. Gruß PD
Nachtrag: ich meinte Produkte aus Westafrika, nicht Südafrika.
Ein fairer Freihandel wäre wohl so wie von Ihnen beschrieben. Aber von einem fairen Freihandel sind wir Lichtjahre entfernt. Daher kann ich den Artikel nicht nachvollziehen. Bedeutet liberal jetzt Konzernlobbyismus?
Schauen Sie doch nach Westafrika. Was hat der Freihandel mit dem Westen bzw. mit Europa gebracht? Dazu muss die eigentliche Frage geklärt werden: wozu überhaupt Freihandel? Nach der derzeitigen neoliberalen Haltung ist Freihandel ausschließlich für die Industrienationen von Vorteil. Denn die schon bei der Geldschöpfung aus dem Nichts anfallenden Zinsen sind der eigentliche Grund dafür, dass die Wirtschaft dauernd wachsen muss. Sagen Sie mir ein Produkt aus Südafrika, bei dem wir fairen Handel hätten. Beim Ausbeuten der Fischgründe vielleicht?
Daher auch das europ. Tiefkühlhähnchen zum Spottpreis in Westafrika, zu dessen Preis der Bauer vor Ort nicht ansatzweise produzieren kann. Dann hört der auf und ein regionaler Arbeitsplatz geht verloren. Und Fluchtursachen entstehen. Kenia hatte das sehr gut erkannt und sich massiv gegen ein Freihandelsabkommen mit der EU geweigert. Erst die Androhung von Kürzungen bei der Entwicklungsländern schafften „Abhilfe“.
Der Freihandel öffnet so auch Wege für „Entwicklungshilfe“ von Konzernen. Sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass Entwicklungshilfefonds einem guten Zweck dienen. Dort, wo die Konzerne Entwicklungshilfe übernommen haben, gibt es Landenteignung im großen Stil, Monokulturen, die zum Teil völlig ungeeignet sind, zu denen westliche Entwicklungsministerien aber Unsummen an Subventionen zahlen – kurzum: Business as usual.
Oder nehmen Sie NAFTA. Begeisterte Mexikaner, die jetzt diktiert bekommen, was sie zu welchem Preis anbauen müssen, sprechen nicht gerade in großer Begeisterung. Dafür gibt es eine kleine Gruppe Profiteure vor allem in urbanen Regionen wie Mexiko Stadt. Die ausgebildeten Facharbeiter in Detroit werden ihnen wohl auch eine ganz andere Geschichte erzählen, aber gewiss keine von Begeisterung für Freihandel.
Und Schiedsgerichte. Auch hier hat sich inzwischen eine regelrechte Industrie gebildet, die nur darauf spezialisiert ist, nach Fällen zu suchen, in denen das Klagen gegen Staaten im Rahmen der Freihandelsabkommen lohnt. Da gibt es Fonds dazu. All diese Auswüchse und das Schließen von geheimen Absprachen von einer Handvoll Anwälte und Konzernlenkern, ob und wie viele Steuern sie von Millionen Steuerzahlern als Ersatz kassieren können, das soll gut sein?
Übrigens bin ich für Freihandel. Der sähe aber anders aus: Verbesserungen und Vorteile für Verbraucher und nicht wie im derzeitigen neoliberalen System für Konzerne. Denn beantworten Sie nur diese Frage: welche Legitimation oder Daseinsberechtigung hat überhaupt ein Konzern? Das Wohl der Menschen oder der Investoren? Der Investoren. Und genau deshalb funktioniert Freihandel nach aktuellen Maßstäben nicht. Und hat nichts mit Fortschritt sondern Feudalherrschaft und Ausbeutung zu tun.
Ich lebe selber in einem Entwicklungsland und habe die tollen Vorteile quasi vor der Haustüre. Neoliberalismus in Form von Freihandel ist nichts anderes als Neokolonialismus. Und wo Industrieländer untereinander Freihandelsabkommen schließen (CETA, mit dem TTIP dank NAFTA doch irgendwie kam – sehr geschickte Blendung), da werden Löhne gekürzt. Heute muss eine Familie erheblich mehr arbeiten, um den Standard in den 1980ern mit einem Arbeitnehmer in der Familie zu erreichen. Es muss ja billig produziert werden.
Und Freihandel wird nie etwas zum Wohl der Menschen sein, so lange das Geldsystem mit Geldschöpfung aus Nichts und obendrauf Zinsen immer mehr Wirtschaftswachstum erforderlich machen.Ich weiß echt nicht, wie Sie mit Blick auf die weltweiten Zustände, die Ausbeutung, die prekären Lohnverhältnisse, der riesigen Macht von Konzernen, der Massenmigration, Monokulturen von Konzernen in Entwicklungsländern mit Freihandelsverträgen, arbeitslosen Facharbeitern, weil im billigen Entwicklungsland produziert wird, einen tollen Freihandel sehen. Apple ist ein Paradebeispiel mit der Produktion in China und den ganzen Suizid-Arbeitnehmern in China. Alles wohl weil Freihandel so „befreiend“ ist, oder?
Das aktuelle Wirtschaftswachstum in den USA beträgt 2,5%,also genau wie zuletzt unter Obama. Ob Obama oder Trump, wirtschaftlich spielt es kaum eine Rolle, wer in Amerika Präsident ist. In einem unfassbar grossen Land wie den usa ist die Macht des Präsidenten nur halb so gross wie viele denken trumps Einfluss wird dramatisch überschätzt. Das war bei Obama auch so
Ich bin auch ein Befürworter von Freihandel. Aber hat nicht die EU Strafzölle u.a. auf chinesische Solarzellen verhängt. Es ist immer schön auf andere zu zeigen, aber man sollte zuerst mal vor der eigenen Tür kehren.
Eine der wichtigsten Maßnahmen Fluchtursachen zu bekämpfen, wäre es den afrikanischen Staaten freien Zugang für den EU Markt zu gewähren, wenn sie bestimmte Bedingungen zustimmen, wie z.B. die Zusammenarbeit bei der Rückführung von unerwünschten Personen und Einhaltung von menschrechtlicher Standards. Dies impliziert im Gegenzug aber nicht, dass die EU hoch subventionierte Produkte (Bsp. Milchpulver) zollfrei nach Afrika liefern kann oder sich Fischereirechte vor den Küsten sichert und den dortigen Fischern die Lebensgrundlage nimmt. Niedrig produktive Länder können nie mit hoch produktiven Ländern auf eine Stufe gestellt werden. Diese werden immer verlieren. Deshalb müssen diese natürlich Zölle erheben um ihre niedrig produktive Wirtschaft zu schützen. Im Gegenzug bräuchte man keine Entwicklungshilfe mehr bezahlen.
Natürlich braucht es neutrale Schiedsgerichte. Ich wäre froh ich könnte ein neutrales Schiedsgericht anrufen, wenn ich mal wieder Streit mit dem Finanzamt habe. Staatliche Gerichte sind ein Grundübel, wenn man mit dem Staat Streit hat. Man stelle sich mal vor, wenn man Streit mit Google hat und Google sagt kein Problem ich stelle und bezahle den Richter….
„Plädoyer für den Freihandel“ Auf Ihren Artikel kann ich nur mit Sarkasmus antworten.
Wie sieht der Freihandel mit Haiti oder einem anderen armen Land aus?:
http://amerika.sebaworld.de/haiti/export.php
Wie finanziert Haiti sein andauerndes Handelsbilanzdefizit? So wie Griechenland, durch steigende Verschuldung, wohl kaum. Die Urlaubshotels, auf Haiti, dürften sich auch schon längst in den Händen von ausländischen Investoren befinden. Haitis Exportindustrie, mindestens zum großen Teil. Und das die Haitianer in Wohlstand leben ist mir leider entgangen. Herr Zitelmann, können Sie mir erklären warum Haiti immer weiter Handelsbilanzdefizite einfahren kann? Ich hab keine vernünftige Erklärung dafür gefunden?
Tja, und den „Haitis“ gibst genug auf der Welt, wo die Menschen in absoluter Armut leben. Nix mit „Freihandel für eine gerechtere Welt“ wie mir der beworbene Buchtitel glauben machen will.
Dann fehlt da noch die Frage: wo ist der Vorteil für eine Exportnation? Der Exporteur wird nur liefern, wenn er in passender Währung (realen Tauschgütern) bezahlt wird.
Bleibt noch das Stichwort Entwicklungshilfe:
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/haiti-die-internationale-hilfe-laeuft-gefahr-die-partner-zu-ersetzen-statt-zu-staerken/
Auch mit Entwicklungshilfe wird woanders Geld „verdient“! Sei es die internationalen Hilfsorganisationen, oder die Global agierenden Konzerne, welche ihre Produkte in Haiti billiger anbieten können, als die Haitianer selbst.
Naja, wenn Herr Schäffler ernst genommen werden will sollte das Chlorhühnchen in zwei Sätzen abhandeln.
Mein Vorwurf an die TTIP-Befürworter ist der, dass sie weder jemals in grenzübergreifender Forschung und Entwicklung, noch in internationaler Produktzulassung tätig waren und keine Ahnung von den möglichen Hürden haben, die in einem Abkommen nicht abgedeckt werden.
Man muss auch mal beantworten, wie ein Handel frei sein kann, wenn das eine oder andere Land nahezu unendlich Zugang zu Finanzmitteln gewährt (auch Stichwort $-Hegemonie), die Handelspartner diese Möglichkeit aber nicht haben.
Wäre denn nun China dort wo es heute ist, hätte es vor 30 Jahren ein Freihandelsabkommen gegeben? China hat durch seine Zulassungsbedingungen Know How erpresst, andernfalls wäre es heute noch eine verlängerte Werkbank der USA. Die Größe des chinesischen Marktes ist ein asset, das China nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat.
Die USA haben umfassende Mittel zur Industriespionage, im Zweifel würden US-Firmen den deutschen via TTIP eine lange Nase drehen. War im Freihandelsabkommen nicht vorgesehen.
Wenn amerikanische Anwaltsfabriken hinter geschlossenen Türen geheime (unkündbare!?) „Freihandelsverträge“ aushecken ist das ganz bestimmt gut für D. Das glauben wirklich nur noch lupenreine Transatlantiker.
Wenn stattdessen die „Amerikaner“ (NSA&Co) mal mit Ihrer umfassenden Wirtschaftsspionage insbesondere in D auf hören würden (lesen Sie Dr. Gert Polli, ehem. österr. Geheimdienstchef)), wäre das hingegen mal ein erster Schritt und schon viel gewonnen.
Freihandelsabkommen können bei einem zwischen den beteiligten Staaten eine gute Sache sein, WENN diese ein ausgeglichenes Einfuhr-/Ausfuhr-Verhältnis aufweisen.
Jetzt das ABER, wenn aber ein Staat auf einen Produktionszweig hat, aber etwas teurer produziert als der andere Staat, wird im ersten Staat über kurz oder lang, zumindest diese Gefahr besteht ja, dieser Produktionszweig kaputt gemacht, da die ausländische Konkurrenz billiger produziert. Staat 1 wird also irgendwann auf die Einfuhr dieser Waren angewiesen sein und Staat 2 kann die Bedingungen diktieren.
Um auf TTIP zu kommen, war es nicht so, das laut den Verträgen die Schiedsgericht amerikanische Schiedsgerichte sein sollten? Wo wäre denn da die Neutralität dieser Gerichte gewährleistet gewesen? Und gab es nicht auch in den TTIP-Verträgen Passagen, das amerikanische Unternehmen, wenn sie bestimmte Produkte, die in der EU keine Zulassung bekommen hätten zB. wegen der Lebensmittelverordnung, trotzdem diese Lebensmittel durch den Klageweg auf den EU-Markt hätten einführen können? Dies wäre ja ein Eingriff in deutsches bzw. EU Recht durch die USA gewesen.
Hier wird zwar bemängelt, das einheimische Unternehmen mit Zöllen unter einen Schutzstatus gestellt werden und so anderen Unternehmen ein Markt verschlossen werden kann, was an sich auch richtig ist, aber was teilweise auch notwendig sein kann. Warum und aus welchen Gründen? Um zB. Arbeitsplätze im Land zu erhalten, um gewisse Produktionsmöglichkeiten im Land zu schützen (um nicht irgendwann völlig auf Importe angewiesen zu sein) und um sehr billig (vielleicht im anderen Staat mit Subventionen) hergestellte Waren auf ein Preisniveau anzuheben in dem diese im eigenen Land produziert werden (können).
Ein Beispiel zum letzten Punkt: Die EU hat Freihandelsabkommen mit einigen afrikanischen Staaten, die EU verschifft über diese Freihandelsabkommen Hühnchenfleisch und Tomaten an diese Staaten, da in der EU Landwirte für das produzierte Hühnchenfleich und die Tomaten bekommen Subventionen bekommen, können diese so billig produzieren, das selbst mit den Transportkosten, diese Produkte häufig billiger angeboten werden könne, wie das in den afrikanischen Staaten produzierte Hühnchenfleich oder die Tomaten. Also werden dadurch die afrikanischen Produzenten von Hühnchenfleich und/oder Tomaten faktisch kaputt gemacht und diese Staaten sind somit abhängig von Importen und bei Neuverhandlungen von Freihandelsabkommen erpressbar.
Ansonsten ein guter Artikel Pro-Freihandelsabkommen, aber leider haben sie die negativen Effekte die auch aus Freihandelsabkommen entstehen können leider unerwähnt gelassen. Ich glaube es ging in diesem Artikel nur um das Buch, trotzdem wäre es gut gewesen, Contra-Freihandelsabkommen-Punkte trotzdem auch in Artikel einzubauen. Freihandelsabkommen (können) funktionieren, aber nur bei (annähernd) gleichstarken Handelspartnern.
Mmh, ein sehr schwaches Buch mit lächerlich einseitiger Propaganda! Wenn ich lesen muss:
„Schiedsgerichte“, so Schäffler, „schaffen Rechtssicherheit für ausländische Investoren. Diese müssen sich nicht auf nationale Richter verlassen, die vom dortigen Staat bestellt und bezahlt werden.“ (S. 53) Gerade Schiedsgerichte sind ein großes Verdienst der Freihandelsbewegung.“
Kann ich nur lachen! Dann soll sich der gute Herr Schäffler doch bitte mal die tollen unparteiischen Schiedsgerichtssprüche des Freihandelsabkommens von Kanada und Mexiko zu Gemüte führen! Und dann darf er dem gemeinen Freihandelsgegner bitte erklären warum sämtliche Entscheidungen grundsätzlich zu gunsten der USA/amerikanische Unternehmen gefallen sind!!!!! Zufall??? Wohl kaum aber lassen wir ihn weiter vom tollen Freihandel träumen!
Beste Grüsse
Sie haben also die Begabung Merkels, Bücher zu beurteilen, ohne sie lesen zu müssen.
Hallo, in dem von Ihnen besprochenen Bändchen fehlt allerdings das Kapitel, in dem mir erklärt wird, warum die TTIP-Verhandlungen im Geheimen geführt wurden und auch die sog. EU-„Abgeordneten“ den Vertragsentwurf nur im streng überwachten Kämmerlein lesen durften. Hm. Das machte doch nachdenklich. Ein Büchlein zu schreiben über Verträge, die keiner lesen durfte, ist vielleicht einfach. Wenn private Schiedsgerichte ein tolle Sache sind – und da ich keine Ahnung habe, will ich das mal unterstellen, dass das so sein könnte – dann wäre eine öffentliche und vielleicht auch langwierige Diskussion doch sehr sinnvoll gewesen: ich bin zum Beispiel vom Kapitalismus, oder vielleicht lieber ‚der freien Marktwirtschaft‘, vollkommen überzeugt, Ergebnis der wirtschaftlichen Evolution des Westens während einer langen auseinandersetzungsreichen Geschichte. Da musste man auch nix geheim halten vor mir. Und die privaten Schiedsgerichte können durchaus hilfreich sein – oder auch der Unterdrückung einiger Interessenträger oder Wirtschaftsteilnehmer(Innen 🙂 dienen. Lieber Herr Zitelmann, Freihandel benötigt genau eine Seite Text, oder nur ein paar Sätze, z.B.: „Die Wirtschaftssubjekte sind frei Geschäfte zu machen, Handel zu treiben, Verträge zu schließen, wie und mit wem immer sie mögen, unabhängig in welchem Staat oder Nation sie tätig sind oder sein wollen“. Vielleicht noch ein Satz über Steuern und einer über die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmers. Der Handel aufgrund eines Vertrags mit tausenden von Seiten und Regeln ist – vermutlich – alles andere als frei. Mein Dank an Herrn Trump diesem Unfug mit einem Satz ein Ende gemacht zu haben. (Danke auch für den Ausstieg aus dem Paris Accord.) Und und und…
Die Industrie als Gegner des Freihandels zu bezeichnen ist scbon ein ganz dreistes Stück von fake news. Gerade die Industrie mauschelt hinter geschlossenen Türen geheime, unkündbare „Freihandelsverträge“ aus, also „Verträge“, die das Handeln frei von jeder Regulierung ermöglichen, völlig einseitig zu Lasten von Staaten und deren Bevölkerung
„Fake news“ oder vielleicht eher: ungenaues lesen??!
Lesen Sie vielleicht die Besprechung nochmal. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand schreibt „die Industrie“ (habe ich gar nicht) oder :
„die Industrie, die vom Protektionismus profitiert.“
statt „die“ können Sie auch „jene“ lesen.
Man kann internationale Schiedsgerichte kritisch betrachten und trotzdem für den Freihandel sein. Dies ist gewiß kein Widerspruch, zumal für jeden denkenden Menschen die Segnungen der internationalen Arbeitsteilung klar erkennbar sind. Und übrigens: Investitionen sind nun einmal immer mit Risiken behaftet.
Sehen Sie es mal so: Angenommen es käme ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU ohne Schiedsgerichte zustande. Hätten Sie dann, wenn ein amerikanisches Gericht zuständig wäre, im Falle einer Streitigkeit das Vertrauen, dass dieses Gericht völlig unvoreingenommen auch im Sinne eines involvierten deutschen Unternehmens entscheiden würde?
Auch wenn diese Entscheidung den Interessen des Wirtschaftsstandortes USA zuwiderlaufen würde?
Und die USA sind immerhin noch ein Land mit einer entwickelten und weitgehend unabhängigen Rechtssprechung. Wie wäre das erst bei Abkommen mit Ländern wie Mexico oder, um mal in eine andere Richtung zu schauen, mit China?
Genau wegen solcher Interessenkonflikte und Unwägbarkeiten werden bei Freihandelsabkommen oft unabhängige Schiedsgerichte vereinbart. Und da für diese kein einzelner Staat mehr zuständig ist, sind das eben naturgemäß private Gerichte.
Dann sollen Sie halt ihre Produktionsstandorte dort aufstellen, wo Rechtssicherheit vorhanden ist, wenn die Rechtssicherheit, Inländische und Ausländische Produzenten ungleich behandelt!
Stellen Sie sich mal vor, kein Autohersteller beliefert Griechenland. Ich sage Ihnen voraus, innerhalb von zwei Jahren hat Griechenland eine inländische Autoindustrie.
Das wäre der Weg, den alle Globalisierungsgeschädigten gehen müßten, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.
Und jetzt stellen Sie sich jetzt vor, alle Staaten verbieten im eigenen Land die Investitionen von Ausländern. Dann könnten die Investoren ihr Geld nur noch im eigenen Land investieren.
Dann braucht es nur noch: Das die Verschuldung eines Staates in Fremdwährung verboten ist. Kein Geld für Importe – keine Lieferung – eigene Herstellung – vorhandene Arbeitsplätze bleiben im Land – Gewinne der Unternehmen auch. Der Weg für eine gerechte internationale Arbeitsteilung wäre dann frei.
Wie waren noch mal die Globlisierungsvorteile? Das Steuern dort bezahlt werden wo wenig anfällt. Das nur dort investiert wird, wo Subventionen und Ausbildung der „Mitarbeiter“ (Ausgebeuteten) sehr hoch, und die Löhne niedrig sind, ansonsten überlässt man die „Drecksarbeit“ (Herstellung) gleich den heimischen Produzenten! Diese Form der Globalisierung schadet allen Staaten und den meisten Bürgern dort. Ich brauch keine Globalisierung – ich konnte mir auch vor der Globalsierung fast alles kaufen was mein Herz begehrte – heute nicht mehr möglich!!!
Ein Prosit auf die Rechtssicherheit von Investoren.
Reinhard Peda
Hallo Herr Peda,
danke für Ihre Gedanken dazu.
Da Sie ersthafte Zweifel an der Globalisierung, also an der internationalen Arbeitsteilung anmelden, versuche ich im Folgenden mal zu skizzieren, wie ein radikal anderer Weg aussehen würde. Dann wird nämlich schnell sehr deutlich, was wir dieser „Globalisierung“ alles zu verdanken haben.
Natürlich könnte man Wirtschaft auch auf die von Ihnen vorgeschlagene Weise betreiben.
Wir würden dann in Deutschland z.b wieder unsere Textilien, Fotokameras, Spielwaren, Unterhaltungselektronik, Computer, Telefone u.s.w bis ins kleinste Glied selbst herstellen. Auf unseren Feldern würde wieder Leinen und Hanf für die Faserproduktion wachsen und im Winter würden wir vornehmlich Kohlgemüse und Äpfel essen. In vielen Gegenden würden wieder Bergwerke entstehen, wo nach Kohle für die Heizung und nach Bodenschätzen gegraben würde, die wir für all die Dinge bräuchten, die wir herstellen wollen. Die großen, global produzierenden Branchen wie Automobilbau und Machinenbau müssten gewaltig Federn lassen. Aber dafür würde es wieder viele kleine Betriebe geben, die all die tausend Dinge, die man für die Eigenherstellung braucht, irgendwie herstellen müssten. Es würde wahrscheinlich Vollbeschäftigung herrschen, da all das natürlich sehr arbeitsintensiv wäre. Es gäbe ja nicht mehr die großen Skalenerträge und in vielen Bereichen wären wir wahrscheinlich auch ziemlich ineffizient. Auf hochentwickelte, innovative Produkte müssten wir in dieser Welt wahrscheinlich verzichten, da sich die gewaltigen Investitionen, die dazu erforderlich wären, kaum lohnen würden. Es wäre sogar wahrscheinlich, dass viele Dinge gar nicht produziert würden, da uns schlicht und ergreifend die Arbeitskräfte und die Ressourcen dazu fehlen würden. Daher wäre es auch nicht zu erwarten, dass in Griechenland plötzlich moderene PKWs gebaut würden. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich eher einfache Gefährte. Möglicherweise würde auch die Eselskarre eine Renaissance erleben.
Ja, die Welt wäre eine andere – aber sie wäre vor allem eine viel viel ärmere Welt!
Ich denke, dieses kleine Gedankenexperiment macht in Grundsätzen klar, worin die Vorteile internationaler Arbeitsteilung liegen. Sie ermöglicht es nämlich, dass die Dinge vor allem da produziert werden, wo die „Rahmenbedingungen“ dafür am besten sind. Bei diesen „Rahmenbedingungen“ kann es sich um harte, also unabänderliche Faktoren handeln, wie z.b. klimatische Bedingungen oder Reichtum an Bodenschätzen, es können aber auch eher weiche, also beeinflussbare Faktoren sein, wie Infrastruktur, Bildungsniveau, Know How, bestimmte Traditionen. Es hat z.b. seinen Grund, dass Deutschland international gesehen vor allem im Automobil- und Maschienenbau so stark ist. In diesen Bereichen gibt es hier starke Traditionen, ein ungeheures Know How, welches von Generation zu Generation weitergegeben wurde und wird. Es wäre eine ungeheure Verschwendung von Ressourcen, wenn wir unsere hochspezialisierte Arbeitskraft wieder in Dinge wie Bergbau und Landwirtschaft stecken müssten. Das und vieles andere können andere Länder nämlich viel besser als wir.
Natürlich gibt es Entwicklungen, die wir kritisch betrachten müssen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir unsere Arbeitskräfte ja dauerhaft beschäftigen müssen. Viele dieser Probleme sind jedoch auch hausgemacht, da man leichtfertig vorhandenes Know How hat abwandern lassen, indem man ganze Industrien durch schlechte politische Rahmenbedingungen regelrecht vergrault hat (z.b. Kernenergie, energieintensive Branchen, demnächst vielleicht auch den Automobilbau). Aber unabhängig davon: Zwischen wirtschaftlich in etwa gleich starken Regionen hat sich Freihandel eigentlich immer gelohnt. Ein Land wie Deutschland verdankt praktisch seinen gesamten Wohlstand der Globalisierung. Also vorsichtig mit so grundsätzlicher Globalisierungskritik! Man schüttet da schnell das Kind mit dem Bade aus!
Ein schönes Plädoyer, Herr Zitelmann. Aber Sie werden damit keinen einzigen Freihandelsgegner überzeugen, wenn Sie den Blick nicht auch mal auf die Schattenseiten richten.
Ich bin selbst Ökonom und ein Befürworter von freiem Handel, da ich die Vorteile erkenne. Allerdings sollte man daraus kein Dogma machen. Es ist nämlich keineswegs ausgemacht, dass freier Handel stets für alle Seiten von Vorteil ist. Das hängt sehr von den vereinbarten Rahmenbedingungen und vom jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Freihandelspartner ab. Schlimmstenfalls werden Ungleichgewichte zementiert oder es kommt zu einer massiven Deindustrialisierung der einen Seite. China ist ein schönes Beispiel für diesen Effekt.
Daher ist Trump auch kein Gegner des Freihandels an sich (er hat gerade den Europäern wieder Gespräche angeboten). Vielmehr möchte er die Rahmenbedingungen so aushandeln, dass sein eigenes Land auch davon profitiert. Diese Idee des wirtschaftlichen Nationalismus wurde bekanntlich von Steve Bannon in die Administration getragen. Neu ist sie allerdings nicht. China praktiziert genau das seit langem.
„Der Abbau von Zöllen und Handelsbeschränkungen, so Schäffler, hat mehr zur Bekämpfung der Armut auf dieser Welt beigetragen als sämtliche Entwicklungshilfe-Milliarden …“
Mir ist aber die Armut der Welt egal, allerding die Armut in Deutschland nicht.
Den Menschen hier nutzen gut bezahlte Arbeitsplätze, die gibt es aber nicht, dafür sind nun die Asiaten etwas weniger arm …
Moin moin Doris die kleine Raupe Nimmersatt,
Don nimmt sich die versammelte Burschenschaft in Davos zur Brust, reduziert die Unternehmenssteuern, – es kommen Erinnerungen an „Negativzinsen“ auf -, und schwupp die wupp bauen die Amerikaner die guten Gasturbinen und „wir“ demnächst Eselskarren. Es geht also ganz ohne Freihandel in Richtung Biogas-Agrarstaat und Maiswüstenwachstum.
@Doris die kleine Raupe Nimmersatt,Sie sprechen aus,was auch Ich beim Lesen des Artikels gedacht habe.
Und wer das hier glaubt:Zitat aus dem Artikel:Für internationale ad-hoc-Schiedsgerichte spreche auch die Tatsache, dass Regierungen auf Entscheidungen von nationalen und staatlich bezahlten Richtern Einfluss nehmen könnten. „Diese Gefahr besteht nicht bei Richtern, die einer anderen Nationalität als derjenigen des im Verfahren beteiligten Staates angehören.“ (S. 107),der glaubt auch an den Weihnachtsmann!
Der Artikel ist gut aufgebaut,aber mit sovielen hätte,könnte,wäre……. gespickt,das er mich nicht überzeugen kann.Und Ich bin liberaler,aber auch konservativer.
Für mich gilt Donalds Wort,aber Ich setze ein Germany an erste Stelle!