Wer war dieser Autor, der nach drei Reportagebänden und vier mäßig beachteten Romanen binnen weniger Jahre zwei der wirkmächtigsten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts schrieb? Mit Farm der Tiere trat Orwell in die Fußstapfen von Swifts Gullivers Reisen (1726), mit 1984 hinterließ er der Nachwelt eine Vision, deren zeitlose Authentizität bis heute erstaunt und die im Gegensatz zu sämtlichen zuvor oder danach entstandenen Romandystopien sogar immer brisanter wird. (…)
Wer aber war der Mensch hinter dem Pseudonym George Orwell, der testamentarisch verfügte, dass nach seinem Ableben keine Biografie über ihn veröffentlicht werden dürfe?
Bertrand Russell: «Menschen wie Orwell, die dem Satan seine Hörner und Hufe geben, ohne die er eine Abstraktion bleibt, kann ich nur dankbar sein.»
Cyril Connolly, Eton-Kommilitone und Macher des Magazins Horizon, für das neben T. S. Eliot, Dylan Thomas und Virginia Woolf auch Orwell schrieb: «Er war nicht fähig, sich die Nase zu putzen, ohne über die in der Taschentucherzeugung herrschenden Bedingungen zu dozieren.»
Susan Watson, Orwells Haushälterin und Kindermädchen des Adoptivsohns Richard: «Für meine Begriffe war er eine seltsame Mischung aus Anteilnahme und Empfindungslosigkeit den Motiven und Verletzlichkeiten anderer Menschen gegenüber.»
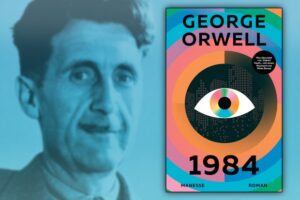
Eine Vision, die immer realer wird: »1984« von George Orwell
Prägende zehn Jahre verbringt der junge Blair ab 1911 in Internaten. Über seine Zeit als Zögling der Privatschule St. Cyprian’s in Eastbourne, Sussex, am Ärmelkanal verfasst Orwell später eine kompromisslose Abrechnung. Als «King’s Scholar»-Stipendiat lernt er von 1917 bis 1921 am Eton College. Er ist neunzehn, als er nach Britisch-Indien zurückkehrt, um als Polizeioffizier in den Kolonialdienst einzutreten.
Der Lulatsch, hager, über 1,90 m groß, bleibt in jeder Beziehung ein Außenseiter. Während seiner fünf Jahre in Birma, heute Myanmar, beginnt er zu schreiben und fasst den Plan, der Kluft zwischen snobistischer Erziehung und engster Nähe zu Unterdrückten und Ausgebeuteten ein authentisches Wirken entgegenzusetzen. 1927 quittiert er den Dienst und schließt sich den Tramps im Londoner East End an. Er durchwandert ganz England, jobbt in Paris als Lehrer, Reporter und Tellerwäscher, wird Hopfenpflücker in Kent, schreibt Artikel, unterrichtet an einer Privatschule. Es sind diese zugleich entbehrungsreichen und selbstbestimmten Jahre, die Orwell in den darauffolgenden als schriftstellerisches Fundament nutzt.
Dass er sich über die Motive des Bücherschreibens nichts vormachte, zeigt ein Auszug aus Why I Write, in dem er sich kritisch Rechenschaft ablegt:
«Alle Schriftsteller sind eitel, egozentrisch und faul, und der tiefste Grund ihres Schaffens liegt in geheimnisvollem Dunkel. Ein Buch zu schreiben ist ein grausamer, aufreibender Kampf, wie eine lange schmerzhafte Krankheit. Man würde es auch niemals tun, wenn man nicht von einem Dämon angetrieben würde, der stärker ist als man selbst und der einem unverständlich bleibt. Man weiß nur, dass dieser Dämon identisch ist mit dem Instinkt eines Babys, das durch Schreien die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte. Aber ebenso wahr ist, dass man nichts Lesbares schreiben kann, wenn man nicht fortgesetzt gegen seine eigene Persönlichkeit ankämpft. Gute Prosa ist wie eine Fensterscheibe. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, welcher meiner Gründe am stärksten ist, dagegen weiß ich genau, welchem zu folgen sich lohnt.»
In den politisch sich rasant zuspitzenden 1930er-Jahren veröffentlicht er jedes Jahr ein Buch: Down and Out in Paris and London (1933), Burmese Days (1934), A Clergyman’s Daughter (1935), Keep the Aspidistra Flying (1936), The Road to Wigan Pier (1937), Homage to Catalonia (1938) und Coming Up for Air (1939) – jedes Lebensstation, jedes ein Meilenstein auf dem Weg zu Animal Farm und Nineteen Eighty-Four.
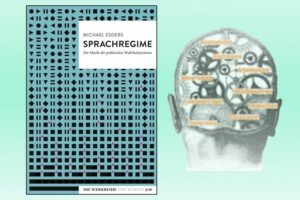
Sprachregime – Die Macht der politischen Wahrheitssysteme
Orwells Bürgerkriegserlebnisse bilden den Glutkern seiner beiden großen Werke. In London verbittet man sich in den ersten Weltkriegsjahren jede Kritik an Stalins Säuberungen und belegt Orwell de facto mit einem Publikationsverbot. Sein Fazit ist bitter, benennt jedoch die neue Zielsetzung: «Das alles erschreckt mich, weil es mir das Gefühl gibt, dass schon der bloße Begriff der objektiven Wahrheit aus der Welt verschwindet. Lügen sind es, die in die Geschichte eingehen werden.» Infolge dieser Erkenntnis ist er nicht länger bereit, sein Selbstverständnis aufzuspalten – hier die eigenbestimmte, dort die gegebenen Machtstrukturen wehrlos ausgelieferte Persönlichkeit. Diese Entscheidung und ihre Konsequenzen sind es, die aus George Orwell den Lord Byron des 20. Jahrhunderts machen.
Vor diesem biografischen Hintergrund kann es kaum verwundern, wenn er bekennt, das reale Vorbild für Architektur, Hierarchie und Praktiken des Ministeriums der Wahrheit sei die BBC gewesen. Zur «Hass-Woche» mögen ihn antijapanische Propagandasendungen der BBC-Asien-Abteilung angeregt haben, wenn auch kaum im selben Maß wie Goebbels’ Hetztiraden.
Orwell bleibt BBC-Redakteur bis 1943. Weil er sich vorkommt «wie eine Apfelsine, die ein schmutziger Stiefel zertreten hat», kündigt er und schreibt fortan für die Tribune seine legendäre Wochenkolumne As I please. Auch seine Gesundheit macht ihm zu schaffen. Während in den letzten Kriegsjahren Animal Farm entsteht, adoptieren die Blairs ein Baby, ihren Sohn Richard. Als Eileen Blair wenige Wochen vor Kriegsende bei einer Operation stirbt, entschließt sich Orwell trotz zunehmend akuter TBC-Symptome, das Kind allein großzuziehen. Animal Farm macht ihn unterdessen zum gefeierten Sprachrohr eines gleichermaßen poetischen wie politischen Literaturverständnisses, das mit jeder Verbrämung totalitärer Denk- und Gesellschaftssysteme rigoros aufräumt. Nochmals der Autor von Why I Write:
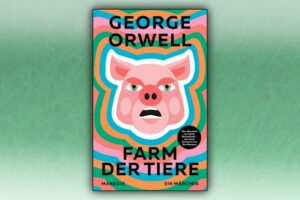
Mit Orwell im Schweinsgalopp zurück in die Sowjetunion
Hätte Orwell 1984 nicht 1948 beendet, sondern erst im Jahr darauf, der Roman würde wohl 1994 heißen – basiert doch sein Titel vermutlich auf einem zugleich simplen und genialen Zahlendreher. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass Orwell seine Jahrhundertdystopie – die sich ebenso gut als schockierende Diagnose urbaner Kontaktarmut und Verkümmerung aller zwischenmenschlichen Bezüge im grauen Einerlei der durchfunktionalisierten Großstadt lesen lässt – nicht etwa in London, sondern in völliger Abgeschiedenheit auf einer schottischen Hebrideninsel schrieb.
Mehrmals zieht er sich nach Eileens Tod jeweils monatelang zusammen mit dem Jungen in das Farmhaus Barnhill auf Jura zurück. Der nächstgelegene Hof ist zehn Kilometer entfernt. Orwell bringt Richard Lesen, Schreiben, Rechnen und Angeln bei und arbeitet bis tief in die Nacht an seinem Buch. Barnhill wird sein archimedischer Punkt, hier findet er mußevolle Ruhe und gebührenden Abstand, um mit Vorstellungskraft und Erfindungsgabe ein so komplexes narratives Gebilde wie 1984 zu konstruieren. Ursprünglich sollte der Roman The Last Man in Europe heißen, und tatsächlich wird sich George Orwell auf Jura nicht selten wie der letzte Mensch in Europa vorgekommen sein.
Auch ein langer Sanatoriumsaufenthalt kann die Tuberkulose nicht eindämmen. Kurz nach Erscheinen von Nineteen Eighty-Four heiratet Orwell im Herbst 1949 Sonia Brownell, die er als Connollys Assistentin bei Horizon kennengelernt hatte und nach deren Vorbild er Winstons Geliebte und Komplizin formt: «das Mädchen aus der Prosa-Abteilung» – Julia.
Während der Vorbereitungen auf einen Sanatoriumsbesuch in der Schweiz erliegt Orwell am 21. Januar 1950 in einem Londoner Krankenhaus einer Lungenblutung. Wie Albert Camus, der fast auf den Tag genau ein Jahrzehnt später verunglücken sollte, wird Eric Blair nur sechsundvierzig Jahre alt. «Sein Leben war eine konsequente Folge von Revolten wider die soziale Tyrannei im Allgemeinen und die physische Tyrannei, die seinem Körper auferlegt war; wider die große Drift der Menschheit auf 1984 zu und wider seine eigene dem unausbleiblichen Zusammenbruch entgegen», schreibt Arthur Koestler in einem Nachruf. Nach George Orwells politischem Vermächtnis gefragt, antwortete Koestler: «Keiner sollte arm sein, und niemand sollte bestimmen können, was andere Menschen zu denken und zu tun haben.» (…)
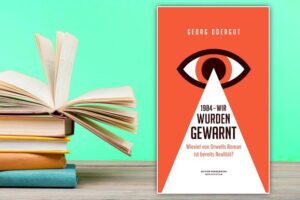
Neue Lügen aus dem Ministerium für Wahrheit – Orwell gestern und heute
Orwell gibt früh einen Hinweis darauf, dass 1984 möglicherweise von Winston Smith erzählt wird, und zwar rückblickend, sodass die titelgebende Jahreszahl auch für das Jahr stehen kann, in dem er seinen Bericht dem geheimen Tagebuch anvertraut. Am Ende des zweiten Kapitels – Winston ist zu Hause – kommt es zu folgender Szene: «Er war ein einsamer Geist, der eine Wahrheit äußerte, die niemand je hören würde. Aber solange er sie äußerte, war auf geheimnisvolle Weise die Kontinuität gewahrt. Nicht indem man sich zu Gehör brachte, sondern indem man nicht wahnsinnig wurde, bewahrte man das Erbe der Menschheit. Er ging zum Tisch zurück, tunkte die Feder ein und schrieb: An die Zukunft oder die Vergangenheit, an eine Zeit, in der das Denken frei ist und die Menschen verschieden voneinander sind und nicht allein leben – an eine Zeit, in der es Wahrheit gibt und Getanes nicht ungetan gemacht werden kann: Aus der Zeit der Gleichförmigkeit, aus der Zeit der Einsamkeit, aus der Zeit des Großen Bruders, aus der Zeit von Doppeldenk – Grüße!« (…)
Von Arroganz bis Zynismus, von Abscheulichkeit bis Zugrunderichten findet sich in Orwells Ur-Dystopie über einen ebenso grauen wie grausamen totalitären Staat alles, was man sich in den schlimmsten Albträumen ausmalt. Und dennoch gilt für 1984 dasselbe wie für Albert Camus’ Die Pest: Es ist in jeder Zeile ein unverbrüchlich menschliches Buch. Lautersten Motiven entsprungen, gelingt es auch George Orwells düsterer Versuchsanordnung nicht, den Glauben an die Unerschütterlichkeit der Menschenwürde vollends zu zertrümmern. Jede Leserin und Leser nimmt an dieser Rettung schöpferisch teil.
Gekürzte Fassung des Nachworts mit dem Titel »In einer Welt voller Lügen« von Mirko Bonné, erschienen in:
George Orwell, 1984. Neu übersetzt von Gisbert Haefs, mit einem Nachwort von Mirko Bonné. Manesse Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 448 Seiten, 22,00 €.

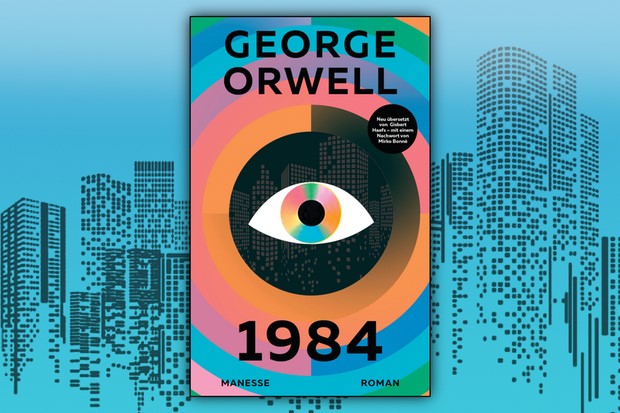
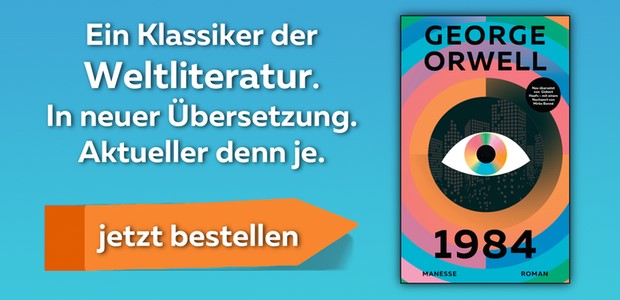
……deutschland ist schon längst über orwell hinaus! auch über brave new world! es muß jetzt aktiv widerstand geleistet werden! sonst ist alles verloren!
all the best von den inseln unter dem wind!
Was sagte noch der legendäre Peter Finch in der Rolle des Nachrichtensprechers Howard Beale in „Network (1976) ?
Genau! https://www.youtube.com/watch?v=nPzuSNKi3VI
Goethes Götz von Berlichingen war übrigens der gleichen Meinung!
Wunderbarer Artikel !
„…gelingt es auch George Orwells düsterer Versuchsanordnung nicht, den Glauben an die Unerschütterlichkeit der Menschenwürde vollends zu zertrümmern. Jede Leserin und Leser nimmt an dieser Rettung schöpferisch teil.“
Zeit für ein Buch, Zeit für Orwell und Camus …
Ich finde, dass viele Leute sich zu sehr auf die Dystopie von Orwell fixieren.
Bis auf das Neusprech (was aber auch nicht ganz richtig ist, weil unsere Sprache eher verkompliziert wird anstatt verarmt), sind wir keine Gesellschaft, die sich ständig im Krieg befindet und uns an allen mangelt. (Srry, die meisten sind momentan noch eher eher gepampert vom Staat)
Orwell richtet sich an klassische Diktaturen, in dem Unterdrückung direkt und sichtbar stattfindet.
Schaut man sich Aldeus Huxleys schöne neue Welt an, sehe ich mehr Parallelen zu heute, was das ganze sogar noch schlimmer macht.
Hier wird eine Gesellschaft beschrieben, den es aber an nichts fehlt.
Niemand muss hungern und es gibt keine Gewalt. Man kann sogar pimpern mit wen man will und sich mit Soma jeden Tag volldrönen.
Das große Aber ist, dass allen Menschen sämtliche höhere Bestrebungen aberzogen werden.
Neugierde, Kreativität und familiärer Zusammenhalt werden durch chemische und psychologische Manipulationen systematisch unterbunden, was zur Folge halt, dass technologische Weiterentwicklung zur Stillstand gekommen ist.
Wissenschaft existiert nicht mehr, auch keine Grundlagenforschung, weil es von der Weltregierung als Bedrohung ihrer vorherrschenden Ideologie aufgefasst werden.
Bedeutsame Kunst existiert auch nicht mehr, da die Leute sich schon mit Pornos und stumpfe Actionfilme zufrieden geben.
Die Menschen sind kindliche Konsumenten ohne höhere Ziele. Und falls es doch Individuen, die sich all der Manipulation widersetzen können und somit unintegrierbar für das Weltregime, werden sie einfach auf ne Insel verbannt.
Aber das allerschlimmste an Huxleys Dystopie ist, dass kaum einer sich gegen das System auflehnen will. Denn wieso denn auch, wenn die eigenen Bedürfnisse kaum über das kleinkindliche „sofort haben wollen“ hinausgehen, sind sie glücklich, solange es genug zum fressen, f***Ken und zudröhnen gibt?
Mir kommen diese Eigenschaften erschreckend bekannt vor…
Kleiner Einspruch zu dem ansonsten sehr guten Kommentar. Seit 1948 gab es immer irgendwo Kriege auf der Welt und in den 40 Jahren nach Erstellung von 1984 gab es den einen großen, wenn auch kalten, Krieg. Vieles im Roman 1984 erinnert an diese Zeit, wenn man die Welt hinter dem eisernen Vorhang betrachtet, der ja 1984 auch noch existierte.
Was das Gegenüberstellen von 1984 und schöne neue Welt angeht so werden unterschiedliche Zukunftsvisionen beschrieben.Dabei ist Orwell vielleicht ein wenig näher an der Vorstellbarkeit des real Machbaren und innerhalb der Grenzen vorstellbarer menschlicher Grausamkeiten geblieben, was eine größere Fixierung auf sein Werk erklären könnte.
Aber viel mehr als die unterschiedlichen Zukunftsbeschreibungen sehe ich die Schnittmengen der beiden Werke. Das Totalitäre, die Kategorisierung von Menschen, die Schaffung, die Modellierung des Menschen, insbesondere auf intellektueller Ebene. Die Missachtung und Abschaffung des Individiums und dessen Freiheit.
Ich finde, dass viele Leute sich zu sehr auf die Dystopie von Orwell fixieren…….
Vergessen Sie bitte nicht, dass Neubundesländler andere Erfahrungen mitbringen. Sie kennen die Sozialistische Diktatur, Mangelwirtschaft, Mauerschießbefehl und den täglichen idiologischen Krieg gegen den verhassten Klassenfeind.
Es gibt ja auch eine Ausgabe vom DTV mit einem Vorwort von Robert Habeck. Zu diesem dystopischen Griff ins Klo gab es bei Amazon dutzende Kommentare. Was glauben Sie, was wohl nun passiert ist? Nein, der DTV hat das Buch nicht etwa wie unlängst der Carlsen Verlag, der es wagte in einem Kinderbuch den Ursprung von COVID-19 zu benennen, der Entsorgung zugeführt. Nein, Amazon hat alle kritischen Kommentare gelöscht. Willkommen in der neuen, woken Welt.
In den Buchhandel gehen (notfalls an der Hintertür klingeln …) und Jeff Bezos meiden!
Kann ich bestätigen. Die kritischen Kommentare zu Habecks Vorwort, darunter mein eigener Senf dazu, wurden gelöscht.
Aber warum sollte man die DTV-Ausgabe kaufen, wenn 2021 sieben andere Neuübersetzungen dieses Meisterwerks erschienen sind?
Aus dem Ministerium der Wahrheit:
Corona: Jeder Tote ist einer zuviel
Ungetestete Impfstoffe: Wir müssen Tote in Kauf nehmen
die Welt voller Lügen sind die ÖR Sender. „Zweieinhalb Jahre nach dem Brandtod des 26-jährigen Amad A. in der JVA Kleve stellt sich im NRW-Untersuchungsausschuss heraus, dass die TV-Politmagazine „Westpol“ und „Monitor“ mit Hilfe der rot-grünen Landtagsopposition, fragwürdiger Gutachter und manipulierten Zeugenaussagen Polizei und Justiz mit falschen Verdächtigungen überzogen.“ https://www.focus.de/politik/deutschland/oeffentlich-rechtliche-vorverurteilung-wdr-schuert-im-fall-amad-a-hass-gegen-justiz-und-blamiert-sich-bis-auf-die-knochen_id_13090415.html
und die Grünen: „Mit hochrotem Kopf verteidigte der Grünen-Politiker vergangene Woche die Berichterstattung der TV-Magazine „Westpol“ und „Monitor“ über den Brandtod des Häftlings Amad A. in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve am 17. September 2018. Tenor: Der Untersuchungsauftrag beziehe sich nicht auf die Arbeit des WDR. Mit seinem Ausbruch erntete der Obmann der Grünen höhnisches Gelächter bei den Regierungsparteien von CDU und FDP. Denn genau das Gegenteil war der Fall.“
Ich glaube, die überwiegende Mehrheit meiner Generation (1964) hat im Schulunterricht dieses Buch ausführlich behandelt.
Umso schlimmer, dass es anscheinend keinerlei Widerstand gab und gibt, diese Schreckensherrschaft durchzusetzen.
Das Buch war keine Dystopie, es war ein hellsichtiges Orakel.
Es gibt dazu übrigens eine Rede des Richters Christopher Emden (AfD) im niedersächsischen Parlament, der schon am 28. Februar 2019 über „Doppeldenk und Neusprech“ eine fantastische Rede hielt (die kaum einer verstand). Niemand soll sagen, dass man es nicht kommen sah.
«Ich glaube nicht, dass es die Art Gesellschaft, die ich beschreibe, tatsächlich geben wird, aber ich glaube, dass es etwas Ähnliches geben könnte. Überall auf der Welt haben sich totalitäre Ideen in den Köpfen der Intellektuellen festgesetzt, und ich habe versucht, diese Ideen folgerichtig zu Ende zu denken.» Orwells Befund hat in den Zeiten einer cancel culture eine beklemmende Aktualität…
Ich finde George Orwell hatte etwas Ähnlichkeit mit Alois Irlmaier, einem ebenso hageren Zeitgenossen von ihm.
Vielleicht hatte auch Orwell das zweite Gesicht.
Gute Schriftsteller sind meist vergeistigte, etwas weltfremde, oft kränkelnde Charaktere. Eine interessante Biographie hat dieser Mann. Ich hoffe, er bekommt dort, wo er jetzt ist, den vielfachen Lohn für seine Mühen. Er hat sich um die Menschheit wirklich verdient gemacht. Seine beiden letzten Bücher sind hochpolitische, zeitlose Werke, warnende Lehrstücke für auf Abwege geratene Gesellschaften.
Ich habe das Buch Mitte der 80er in der Schule gelesen und vor einer Weile mal wieder. Damals hielt man es für eine Dystopie, heute scheint es mehr, die politisch Verantwortlichen sähen es als eine Arbeitsanleitung. Bezeichnend für die heutige Zeit eine Szene, in der Kollege Winston Smith über die Bedeutung der Neusprache aufklärt:
„Siehst Du denn nicht, daß die Neusprache kein anderes Ziel hat, als die Reichweite des Gedankens zu verkürzen? Zum Schluß werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich gemacht haben, da es keine Worte mehr gibt, in denen man sie ausdrücken könnte. … Mit jedem Jahr wird es weniger und immer weniger Worte geben, wird die Reichweite des Bewußtseins immer kleiner und kleiner werden.“
Das ist nicht gänzlich neu. Auch früher wurde aus dem Kriegs- der Verteidigungsminister, aus der Sondersteuer die „nicht-rückzahlbare Zwangsanleihe“ und derlei mehr. Aber die Veränderung der Sprache, nicht auf natürliche Weise sondern von Parteien und Medien gesteuert, sei es durch gesprochene Gendersternpausen, langatmige Doppelformen, das extensive Partizip-Präsens und die gelegentliche Passivierung von Texten, hat Formen angenommen, die außerhalb jeder Vorstellung lagen. Oder man denke an das N-Wort, in meiner Schulzeit noch ganz unverfänglich in Erdkundebüchern stehend, das mittlerweile über die Zwischenformen „Schwarzer“, „Farbiger“ zur „Person of Color“ mutiert ist, nur daß man das nicht mehr ins Deutsche übersetzen kann – eine „Farbperson“, was sollte das sein?
Vor ein paar Tagen gab es bei meiner Firma – reine Tech-Company, Mitarbeiter zumeist männlich und weiß oder indischer Herkunft – ein Diversity-Inclusion-Webinar. Per Zoom war man eingeladen, einer „Speakerin“ zu lauschen. Ich habe mir das tatsächlich eine kurzen Zeitraum lang angetan bzw. auf dem Zweimonitor mitlaufen lassen. So ähnlich stelle ich mir den Orwellschen Televisor aus 1984 vor. Eine hysterische Frau brabbelt irgendeinen Scheiß, laviert zwischen Schlagworten („Rassismus schlecht“, „Power of Diversity gut“), redet dabei permanent wie ein Wasserfall. Man ist genervt, kann sich aber der penetranten Visage nicht ganz entziehen. Zum Glück durfte man es abschalten, ohne seine Arbeit zu verlieren – noch.
Ich habe das Buch erst vor zwei oder drei Jahren gelesen und es bereitete mir teilweise körperlichen Schmerz.
Nie habe ich etwas Eindringlicheres gelesen.
Die Verfilmung aus 1984 mit John Hurt und Richard Burton kann natürlich nicht die komplexen Gedanken von Winston Smith widergeben, fängt die Atmosphäre des Buches aber mM sehr gut ein.
Man muss doch nur mal Churchills „Der Zweite Weltkrieg“ lesen. Da verharmloste Churchill den Stalinismus ganz beträchtlich, weil ihm Stalin nützlich war in der Koalition gegen Hitler.
Der Denkfehler besteht einfach darin, dass die „Guten“ den Zweiten Weltkrieg unisono gewonnen hätten. Gewonnen hat ihn auch Stalin, aber darum blieb er trotzdem ein Schwein, das es verdient hätte, mit Hitler in einem Sarg zu liegen
Ich hätte mir gewünscht, die Politik hätte 1984 als Warnung gesehen und nicht als Gebrauchsanweisung. Aber es ist wohl zu einfach und verlockend die nicht Alternativlosen zu verteufeln statt Probleme zu lösen. Man denke nur an den Umgang mit der Schwefelpartei. Von wegen mit Argumenten stellen.
Die drei besten politischen Romane des 20. Jahrhunderts: „1984“, „Animal Farm“ und Jüngers „Marmorklippen“.
Jünger wurde bereits vor Jahrzehnten von blasierten Schnöseln wie Thomas Mann („Ich habe einen Ehrendoktortitel“) und Hermann Hesse anathemisiert und ist heute eine „nichtexistierende Person“, gegen Orwell läuft derzeit eine großangelegte Schmutz- und Umschreibungskampagne, z.B. in der englischen Wikiblödia, die Orwell als Hampelmann der CIA identifiziert haben möchte.