Adorno nahm eine Idee von Lukács auf, als er das Konzept des »Warenfetischismus« zu einem Teil seiner umfassenden Kulturkritik machte. In einer kapitalistischen Ökonomie, meinte er, würden die Menschen nicht durch andere, sondern durch sich selbst versklavt, indem sie der Anziehungskraft der glitzernden Warenwelt um sich herum erliegen. Ihr »falsches Bewusstsein« verleite sie dazu, der immer gleichen Anziehungskraft nachzugeben, und so werde ihre wahre Freiheit durch die illusorischen Freiheiten der Konsumkultur verdrängt. Adorno hat das Ergebnis der Konsumkultur in Hollywood erlebt und war von ihr angewidert, nicht nur wegen ihrer Vulgarität, sondern auch wegen der entspannten Art, wie die Amerikaner den sie versklavenden Müll zu genießen schienen.
Die Massenkultur ist eine Ware, dessen Aufgabe es ist, den kritischen Geist zu neutralisieren und eine illusorische Akzeptanz einer illusorischen Welt zu erzeugen. Sie ist ein »ideologisches« Produkt im Marx’schen Sinne, ein Schleier, der über die gesellschaftliche Realität gelegt wurde, um an ihrer Stelle eine tröstliche Illusion zu erzeugen. Mit anderen Worten: Die Massenkultur ist ein Teil des falschen Bewusstseins von der kapitalistischen Gesellschaft, und Adorno wollte zeigen, wie sie den Weg zu den wahren Gefühlen umgeht und immer zu Klischees und einer routinierten Sentimentalität führt.
Adornos Hoffnung als Komponist und Musikwissenschaftler war, die kreative Logik der großen Meister, die mit der Realität gekämpft und den ihren Ideen entsprechenden Stil gefunden hatten und niemals vor der Qual des wahren musikalischen Arguments zurückgeschreckt waren, jenem Kitsch gegenüberzustellen, der den kürzesten Weg zum Trost sucht wie die populären Schlager, die sich am Ende zum Tonikaakkord heimschleppen. Der Kulturfetisch ist durch seine »standardisierte« Natur gekennzeichnet, durch die routinierte Präsentation vorverdauten Materials und die Ablehnung, seinen eigenen Status als Ware anzuerkennen.
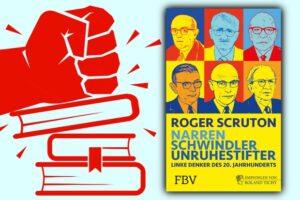
Konservativer Philosoph dekonstruiert die Lieblingstheorien der Linken
Aus der Zusammenführung der beiden Ideen des Warenfetischismus und der Verdinglichung folgt, dass in der kapitalistischen Kultur die freien Beziehungen zwischen Subjekten, auf denen unsere menschliche Erfüllung beruht, durch die alltägliche Beziehung zwischen Objekten überlagert und durch sie ersetzt werden. Das war der großartige Weg – der Weg der klassischen deutschen Philosophie –, um endlich zum Punkt zu kommen: In der kapitalistischen Massenkultur werden Subjekte zu Objekten und Objekte zu Subjekten! Kein Wunder, wenn Adorno glaubte, durch den Schleier der Massenkultur die darunterliegende Realität erblickt zu haben. Er übertrug den Jargon von Subjekt und Objekt auch auf den Bereich der klassischen Musik. Hier ein Beispiel, wie er ihn auf Bach anwendet:
»Bach, als der fortgeschrittenste Generalbassmeister, sagte zugleich, als altertümlicher Polyphoniker, der Tendenz der Zeit, die er selber ausprägte, den Gehorsam auf, um jener Tendenz zu ihrer eigenen Wahrheit zu verhelfen, der Emanzipation des Subjekts zur Objektivität in einem bruchlosen Ganzen, das in Subjektivität selber entspringt.
Es geht um die ungeschmälerte Koinzidenz der harmonisch-funktionellen und der kontrapunktischen Dimension bis in die subtilsten Bestimmungen der Struktur. Das längst Vergangene wird zum Träger der Utopie des musikalischen Subjekt-Objekts, der Anachronismus zum Boten der Zukunft.«
In dem Abschnitt macht Adorno eine alltägliche Feststellung – dass nämlich bei Bach die Logik des Kontrapunkts und der funktionalen Harmonie übereinstimmen, sodass keiner der beiden den anderen dominiert. Aber diese Beobachtung wird umgearbeitet, und nun beinhaltet sie, dass Bach irgendwie die »Utopie des musikalischen Subjekt-Objekts« verkündet. Diese Art Umarbeitung ist typisch für Adornos Taschenspielertricks. Der verwendete Jargon beschwört eine Schlussfolgerung, die Adorno nicht beweisen kann, nämlich dass Bach seine Bedeutung der Tatsache verdanke, dass seine Musik, trotz des antiquierten Stils auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, nämlich auf der Seite, wo nach Utopia gesucht und wo – in objektiver Form – die echte Freiheit des Subjekts bewahrt werde.
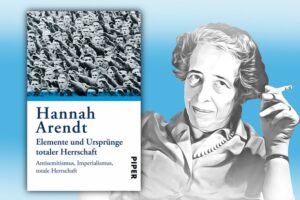
Ohne Massenbewegung ist totale Herrschaft nicht möglich
Um den neuen revolutionären Geist zu erwecken, brauchte man eine Theorie, die nachwies, dass die kapitalistische Freiheit eine Illusion war, eine Theorie, die die wahre, von der Konsumgesellschaft negierte Freiheit aufzeigte. Das war es, was Adorno, Horkheimer und Marcuse geliefert haben. Adornos Angriff auf die Massenkultur gehörte zur gleichen Bewegung wie Marcuses Anklage der »repressiven Toleranz«. Es war ein Versuch, die Lügen zu durchschauen. Die Theorien des Fetischismus, der Verdinglichung, der Entfremdung und der Unterdrückung, die um 1968 herum zirkulierten, hatten ein überragendes Ziel: die illusorische Natur der kapitalistischen Freiheit aufzuzeigen und die kritische Alternative hochzuhalten, eine Befreiung, die nicht zu einer anderen, finstereren Form des Staatskapitalismus führen würde, die, wie behauptet wurde, über Ost und West herrschte.
Indem sie die Kritik am amerikanischen Kapitalismus und dessen Kultur ständig verschärften, sich jedoch nur zurückhaltende und herablassende Hinweise auf den echten Albtraum der kommunistischen Herrschaft erlaubten, zeigten diese Denker ihre bodenlose Indifferenz dem menschlichen Leid gegenüber und ebenso die unseriöse Natur ihrer Empfehlungen. Adorno sagt nicht direkt, dass die »Alternative« zum kapitalistischen System und der Warenkultur Utopia sei. Doch das ist es, was er meint. Utopia jedoch ist keine echte Alternative. Und deshalb ist seine Alternative zur scheinbaren Freiheit der Konsumgesellschaft selbst eine Scheinalternative – eine bloße Idee, deren einzige Funktion ist, das Ausmaß unserer Probleme zu beleuchten. Doch Adorno war sich durchaus bewusst, dass es sehr wohl eine aktuelle Alternative zum Kapitalismus gab, eine, die Massenmord und kulturelle Auslöschung bedeutete. Denn Adornos Ablehnung dieser Alternative als eine nur »totalitäre« Version des gleichen Staatskapitalismus, den er in Amerika erfahren hatte, war von Grund auf unehrlich.
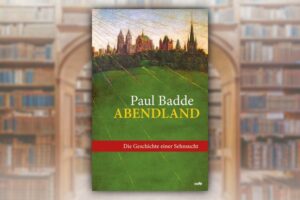
Ein ebenso zeitgemäßes wie unzeitiges Buch: »Abendland«
Adorno glaubte freilich nicht an Gott und hatte auch wenig für die Lehren der Thora übrig – viel weniger als sein Held Arnold Schönberg, der in seinem unvollendeten und nicht vollendbaren Meisterwerk Moses und Aron versucht hatte, die eben dargelegten Ideen als Drama darzustellen. Doch Adornos Angriff auf die Massenkultur sollte in diesem alttestamentarischen Geist gesehen werden, als die Zurückweisung des Götzendienstes und als die Bestätigung der jahrhundertealten Unterscheidung zwischen wahren und falschen Göttern – zwischen der Anbetung, die uns veredelt und erlöst, und dem Aberglauben, der uns in den Abgrund führt. Adornos wahrer Gott ist Utopia: die Vision von freien Subjekten, die sich der Welt in ihrer Realität bewusst sind und sie für sich behaupten. Der falsche Gott ist der Fetisch des Konsumismus, der Gott der Begierden, der unsere Sicht vernebelt und unsere Wahlmöglichkeiten vernichtet.
In dieser Hinsicht unterschied sich Adorno grundsätzlich von den 68er Revolutionären, obwohl er eine Sprache benutzte, die diese glaubten, ebenfalls nutzen zu können. Die Befürworter der »Befreiung« suchten nach einer anderen Gesellschaftsordnung, in der Menschen wahrhaft frei sein würden, frei, weil sie den Schleier der Illusionen zerrissen und begonnen haben, eine weniger repressive Welt zu errichten. Aber die Erlösung, die Adorno versprach, konnte nicht durch Gesellschaftsreformen erreicht werden: Ihm schwebte eine persönliche Erlösung vor, das Zurücklassen der Fantasien auf dem Weg zur Selbstentdeckung.
Wer seinen Geist an eine Utopie heftet, tritt in Verbindung mit seiner Subjektivität und braucht eine wahre geistige Disziplin. Dieser Mensch ist nicht dadurch motiviert, Elend und Leid zu vermeiden, denn er weiß, dass diese die Prüfungen der menschlichen Freiheit sind. Nichts stößt ihn mehr ab als der Fetisch, der aus dem Land der Illusionen stammt und der das höhere Leben verneint und zerstört, weil er Tragödie und Leid verneint. Doch den Trost, den Kythera (die Insel Kythera gilt in der Mythologie als Reich der Liebe, fern aller Konflikte – Anm. d. Red.) spenden kann, verbietet das gleiche moralische Urteil, und eine »Befreiung«, die Sex, Sünde und Müßiggang der Liste der Konsumgüter hinzufügt, ist nur ein neuer Name für die altbekannte Versklavung.
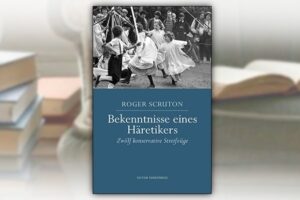
Roger Scrutons konservative Streifzüge
So verstehe ich die Last, die Adornos Kritik der Massenkultur zum Ausdruck bringt. Wie die anderen Kritiken ähnlichen Inhalts von Ruskin, Arnold, Eliot und Leavis entspringt sie der Verdammung des alttestamentarischen Götzendienstes und enthält als solche einen wahren Kern. Die Probleme entstehen dadurch, dass Adorno die Sprache des Marxismus benutzt und der daraus entstehenden Implikation, dass er eine politische Alternative zur »bourgeoisen« Gesellschaft umreißt und auf Mängel hinweist, die durch eine marxistische Revolution überwunden werden könnten. Die einzige Revolution, die sich Adorno vorstellen kann, findet in der Welt der Kultur statt. Sie ist keine politische, sondern eine ästhetische Revolution, der Versuch, Utopia durch die Kunst zu verstehen. Kunst – stellt Adorno fest –, die sich wie die Propagandakunst von Brecht und Eisler direkt in den Dienst der Revolution stellt, verrate die einzige Art von Wahrhaftigkeit, der die Kunst fähig ist. Der Drang zur Utopie müsse innerhalb der Kunst verteidigt werden, durch die innere Revolution der Kreativitätsformen. »Denn der unmittelbare Einspruch (…) wäre in Kunst reaktionär.« Genau auf diese Art konnte Adorno zur 68er Revolution gehören und zugleich ihres Zugriffs entweichen und zum Nachdenken über Dinge zurückkehren, die ihm wirklich wichtig waren, wie die Zukunft der Tonalität, die Natur der Massenkultur und die Herrschaft des Kitsches.
Um die Fußnoten bereinigter Auszug aus:
Roger Scruton, Narren, Schwindler, Unruhestifter. Linke Denker des 20. Jahrhunderts. Edition Tichys Einblick im FBV, Hardcover, 368 Seiten, 25,00 €

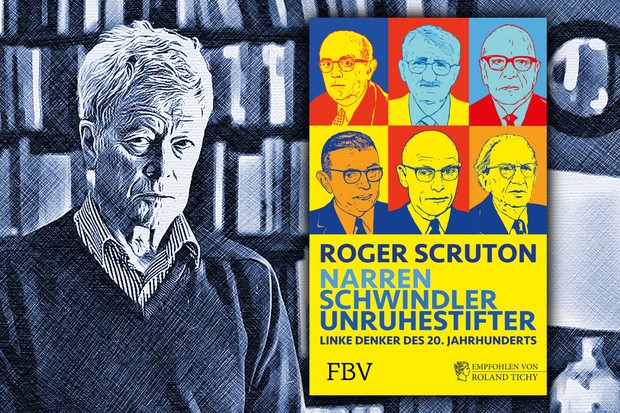
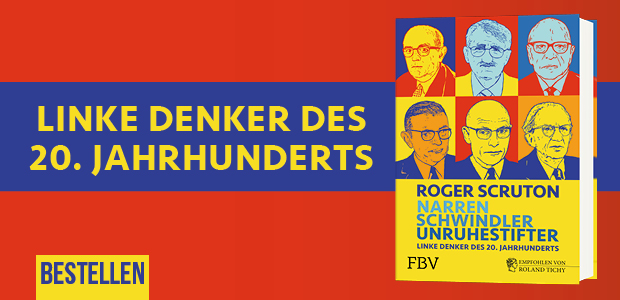
Passt wunderbar auf den herrschenden e-Bike-Wahn.
Die Krisen des Konsums sind Krisen der Vorstellung „vom guten Leben“, die letztlich von Aristoteles sehr unbekümmert in seiner Politika ins Werk gesetzt wurde. Ständig über die Jahrhunderte erfurchtsvoll wiederholt und unkritisch ins Wort gesetzt bis heute, besonders auch im Morgenland. Aber auch Grundlage eines jeden Sozialismus und Materialismus. Die Flachheit des Slogans vom guten Leben schreit natürlich nach Metaphysik um sinnstiftend ergänzt werden zu können, natürlich durch einem „Gott“.
Zum Glück gibt und gab es Sonne, Mond und Sterne und irgendwie konnte das Problem „überzeugend“ im Monotheismus und seinen vielfältigen Spielarten „gelöst“ werden. Wie einem Erdenbürger von klein an allerdings in das jeweilige „befriedende“ Korsett geholfen wird, durch Übung, durch Beschneidung, dem Studium der Tradition oder als schlichte Notwendigkeit in einem feindlichen Umfeld, ist ein Thema für sich, das man gerne still links liegen lässt, wenn man nicht gerade an Theologie interessiert ist. Die Philosophie kann immer nur die Dirne der Theolgie sein, das gängige Fazit dieses Dilemmas, dem ich mich aber nicht anschließe.
Mein Interesse gilt mehr den wirklichen Dingen, weil ich die Hoffnung aufgegeben habe, dass der Gott rein und selbstartikulierend in Form und Inhalt in unserer Neurologie anzutreffen ist und wir ihn erkennen können. Gerechtigkeit in Politik zu gießen, bestimmt jede Kultur und die Erfolge sind überschaubar.
Was Adorno betrifft, war er ein treuer Verfechter der „idealen“ Moral, was man ihm zum Vorwurf machen (Taschenspielertricks) kann oder auch nicht. Dass eine bestimmte Religion auserwählt ist, ist eine charismatische und performative Losung und bis in den letzten Nerv Populismus. Geschmäcker konnen sehr verschieden sein. Gerne schließe ich mich Goethe an, der sinngemäß meinte, Erfahrung sei eine praktische Angelegenheit, nur leider erreichte sie einen meist immer erst kurz nach dem sie benötigte. Mit Gott scheint es sich vielleicht ähnlich zu verhalten?
Es ist schon sehr lange her, dass ich mich mit Adorno befasste.
Diese Interpretation des Ansatzes von Adorno trifft es bisher am besten, wenngleich m.E. „zu positiv“.
Ich habe nunmal Adorno als „Angriff“ auf eine Verstrickung von Mythos und Aufklärung gelesen.
Die Verstrickung schien mir weder aufzulösen sein durch den Mythos, noch durch Aufklärung.
Damit bewegte sich Adorno nicht innerhalb meines Verständnisses von vor allem Aufklärung, aber auch nicht von Göttlichkeit.
Ich denke auch, dass Adorno grob „alttestamentarisch“ argumentiert. Nur argumentiert das Alte Testament auch so oder ist es überhaupt erst der Schritt hin zu einem LEBENDIGEN GOTT, positiv also, den „Stein“, das „Goldene Kalb“ überschreitend, nicht zerstörend, sondern aufhebend? In dieser Tradition sehe ich Jesus Christus und also das Alte Testament zu bewahren suchend.
Nach Adornos Kritik gibt es evtl. keine Moderne, sondern nur die Rückkehr ins Paradies, zum Gott des Alten Testamentes? Wie ist das bei Scruton?
So würde ich nicht an die USA herangehen, aber diese vielleicht selbst an sich?
Spielt das nicht auch bei Heideggers „Gestell“ noch eine Rolle?
Es war damals in den Sechzigern und Siebzigern ganz sicher noch nicht die Zeit irgendeiner Auseinandersetzung oder sagen wir kritischer Befassung mit dem Alten Testament.und dem Neuen Testament, deren Bezüglichkeit, aber auch deren WEITER-entwicklung.
Ich bezweifle fast, dass es das jetzt schon sein könnte, jedenfalls nicht in Deutschland.
Meine hoffentlich höchst respektvolle Strategie war und ist die des Bewahrens dessen, was noch gerettet werden konnte, vor allem der Menschen und die große Hoffnung in sie, dass sie entfalten und weiterentwickeln, was sie von ihren Vätern und Müttern gelernt haben, wenn man sie nur endlich in Frieden leben läßt.
Das ist meine Haltung zu Israel und meine Hoffnung für das Land Israel und Deutschland.
Man könnte aber vielleicht einmal diese Einflüsse auch bei Marx bedenken, den ich evtl. auch deshalb nicht in Gänze annahm, er sich vielleicht selbst nicht.
Aber Marx scheint mir insgesamt positiver als Adorno.
Für meine wissenschaftliche (Nicht-) Entwicklung unterschätze man nicht die besonders in Deutschland verschuldete Last, die in der sinnigen Frage mündet, ob denn ein Gespräch über Bäume überhaupt statthaft sei.
Ich komme niemandem mit der Erbschuld, wohl aber mit der Schuld.
Ich will und kann mir das Denken nicht verbieten, das Sprechen aber nur weitestgehend geöffnet, in der Schwebe gehalten und lieber selbst zerbrechend als andere auch nur anzutasten.
Vielleicht liebe ich deshalb Musik so sehr, sie richtet weniger Schaden an?
Was aber vielleicht doch gestattet ist, um meiner Topoi willen, sind eventuell meine kleinen Einlassungen zu diesem und jenem.
Schuld wird nicht kleiner durch Vergessen, sondern eingebettet in Verantwortung.
Danke für die Mitteilung dieser klugen Anmerkungen. Erlauben Sie mir einige ungeordnete Gedanken dazu.
(A) Die „Kritische Theorie“ hat sich m.E. als philosophisch unfruchtbar erwiesen, anders als ihre Kontrahenten, etwa der Logische Positivismus. Es war zu viel bloßes Gefuchtel, Empörung, auch Demagogie dabei. Heute wird A. nach meiner Wahrnehmung vorzugsweise von Vertretern der sog. Intelligenz zitiert, gerne aus den „Minima Moralia“, weil die so schneidende und entschiedene Sätze enthalten und man derart die Pose der Überlegenheit einnehmen kann.
(B) Das Problem besteht aber darin, dass die meisten Sätze bei näherer Prüfung zerbröseln, dann nämlich, wenn man fragt: „Was ist damit genau gemeint, wie ist das zu verstehen, wie ist das belegt?“ Das Apodiktische löst sich in Unbestimmtes auf. Das ist bei den prätentiösen Satzbildungen des Habermas nicht viel anders: In der Regel handelt es sich um Banalitäten oder unbelegte Behauptungen oder zirkuläre Logik.
(C) Kurios ist es, dass A. ein Buch schrieb, in dem er den „Jargon der Eigentlichkeit“ bei Heidegger entlarvte, der leicht zu imitieren sei. Er selbst war durch einen „Jargon der Negativität“ charakterisiert, der ebenfalls leicht zu imitieren war. Eine Zeitlang war ich von A. fasziniert und vermochte einwandfrei in seinem Jargon zu sprechen, wie viele andere auch. Bis mir das Hohle und Lächerliche bewusst wurde und ich mich als „scientific mind“ davon löste. Siehe auch die diesbezüglichen Anmerkungen von Jean Améry.
(D) Sehr gut finde ich, dass Roger Scruton die jüdische Komponente im Denken von A. herausstellt, ich würde sogar den jüdischen Chiliasmus sehen. Als ich vor einiger Zeit einem Doktoranden der Geschichte davon erzählte, meinte er, bei ihm im Institut habe man diskutiert, ob ein solcher Gedanke nicht bereits Antisemitismus sei. So viel zum Zustand einer dt. Universität.
(E) Was an A. abstößt, ist die aberwitzige Arroganz. Bösartige Bemerkungen etwa zu Ernst Cassirer, der ihm m.E. als Analytiker intellektuell überlegen war. Höhnische Bemerkungen zu einem Kongress der Logischen Positivisten in Paris in den 1930er-Jahren, in dem er diese nicht nur der Dummheit zieh, sondern sich über das schlechte Englisch lustig machte; ich bin mir sicher, dass er nicht ansatzweise verstand, worum es ging. Diese Leute waren im Übrigen gleich emigriert, während er selbst noch vergeblich versucht hatte, sich dem Regime über seine Kritik am Jazz anzudienen. Auch denke ich an die vernichtenden Urteile über Hindemith oder Reger. Eine rigorose, selbstgerechte Moral, ein eilfertiges Rationalisieren (siehe auch die Bemerkungen zu Bach) liefen immer mit. Das Vernichtende seinen Gegnern gegenüber hatte er mit Marx gemeinsam, und man findet eigentlich auch kaum eine produktive Aufnahme der Gedanken anderer, alles kreist um A.
(F) Im Grunde war er vom universalistischen Hegel-Typus, nur dass im 20. Jh. die Konstruktion eines Gebäudes positiver Gedanken nicht mehr möglich war, daher das negative Gebäude, das man sozusagen nur im indirekten Sehen wahrnimmt, die „Negative Dialektik“. Schaut man drauf, ist es weg. In dieser Hinsicht nicht sehr weit von dem „Unsagbaren“ des frühen Wittgenstein, und auch nicht sehr weit von Heidegger. Vor allem aber erinnert es an die jüdische Tradition: Du sollst dir kein Bild machen. Wie gesagt, erkennen allerdings moderne, spürhundige Adaptknemiker darin bereits Antisemitismus.
(G) In den 1960er-Jahren gab es Radiodiskussionen zwischen A. und seinem Antipoden Arnold Gehlen, sie liefen höflich und in wechselseitiger Anerkennung ab, man kann sie nachhören. Heute wäre so etwas unmöglich. Wie 1933 würde die Engagierte Jugend aufmarschieren und randalieren, angefeuert von der geistigen Elite der Böhmermänner.
Danke für diese Ergänzungen. Hinzufügen muss man noch, dass A dann ja selbst zu einem der ersten Opfer der totaltären „Studentenbewegung“ wurde. Bis zu den Böhmermännern im ÖRR und den MSM hat es einige Jahrzehnte gebraucht, heute sind sie fast allgegenwärtig. Die Geister die er rief…
Danke. Er war halt, wie Horkheimer, ein Großbürger aus dem 19. Jh., der vergeblich versuchte, mittels Marx und Zwölftonmusik mit der Entwicklung des 20. Jh. Schritt zu halten. Vor allem scheint er ein schönes Beispiel für die Dominanz des Persönlichkeitstypus in der Philosophie. Hochgebildet und hochintelligent waren auch Ernst Cassirer oder Karl Raimund Popper, aber philosophisch ganz anders. Vergleichen Sie den Entlarvungs-Feldzug in der „Dialektik der Aufklärung“ mit der sorgfältigen, überall durch Quellen belegten Analyse Poppers in „The Open Society and its Enemies“. Bei aller Deutlichkeit der Aussage bemüht sich Popper immer, den Autoren, gleich ob Platon, Hegel oder Marx, gerecht zu werden und auch das zu sehen, was Bestand haben könnte. Umgekehrt gibt es von A. Mitschriften seiner Frankfurter Vorlesungen, die verblüffend differenziert, ja m.E. lesenswert sind und ohne eine elaborierte, apodiktische, quasi-gnostische Verschwörungstheorie auskommen, welche seine nominellen Schriften dominiert. Man glaubt, einen anderen Autor vor sich zu haben.
Ein wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Charaktere, ist die Tatsache, dass Popper etwas unternimmt, was Adorno und die meisten seiner Epigonen auf gar keinen Fall möchten: Popper will nicht nur reden, er will auch verstanden werden!
MAN KRIEGT KOPFWEH,
wenn man den Versuch macht, Adornos verquastes Geschwafel zu lesen. Spätestens nach dem ersten Satz drängt sich einem das Gefühl auf: „Weiterlesen ist vergeudete Lebenszeit.“ „Much ado about nothing“ – um es mit Shakespeare zu sagen. Die Lektüre seiner Dramen ist ein Hochgenuss verglichen mit diesem linken Apparatschikgewäsch, das eine Vergewaltigung des Papiers (zu Adornos Zeiten druckte man noch).
Es gibt wohl kaum einen intelligenten, denkenden Menschen, der einen Großteil unserer Konsumgesellschaft nicht auch kritisch sieht. Da könnte man auf Vieles verzichten, das genau so ein billiger, ressourcenvergeudender Ramsch ist wie Adornos pseudointellektuelle, linke Schwadronade. Die DDR-Mangelgesellschaft (die ein privilegiertes Schoßkind wie Adorno wohl nie erleben und erleiden musste) kann jedenfalls erst recht keine Alternative sein.
So wie die 68-er Hinterlassenschaften insgesamt, so gehört auch Adornos Hirnfolter-Geschmiere endlich in die Mülltonne der Geschichte.
So ist es! Schon Adornos Idol, György Lukács, war der Migränegenerator schlechthin und ein Paradebeispiel, wie man in möglichst vielen Wörtern möglichst wenig sagen kann. Der Kommunist Lukács musste 1956 aus seiner ungarischen Heimat Hals über Kopf flüchten, ansonsten hätte man ihn, wie so viele seiner Genossen, auf einer Straßenlaterne aufgeknöpft. Mein Prof an der Uni war ein Lukács-Fan, das habe ich leider zu spät gemerkt, doch irgendwann ist es mir gelungen, mich im Studium neu zu orientieren. Adorno fällt unter den Satz von André Breton: „Ein Philosoph, den ich nicht verstehen kann, ist ein gemeiner Halunke!“.
Eine gute Analyse, welche die Notwendigkeit einer grundlegenden Auseinandersetzung mit den Strömungen der 50er, 60er und beginnenden 70er Jahre nahelegt. Frankfurter Schule, 68er – Bewegung, sog. Popkultur, so unterschiedlich sich diese auch darstellen, bilden letztendlich ein Konglomerat, das einer intensiven Aufarbeitung bedarf, um die Verwerfungen der Gegenwart verstehen zu können.
Die Aushebelung demokratischer Grundfeste und ein fataler Hang zu autokratischen Denkweisen vor allem in den westlichen Staaten, die sich zur Zeit vollziehen, haben ja darin ihre Wurzeln.
Richtig. Man sollte sich m.E. viel mehr mit dem Poststrukturalismus befassen um seiner zersetzenden Wirkung etwas entgegensetzen zu können.
Roger Scruton wird in den Programmen der Opernbühnen und der Festspiele nicht zitiert, soviel ich bisher sah. Wenn er sich nun beklagt, Adorno könne die Wirksamkeit seiner ästhetischen Theorie nicht erklären, so schließt er vielleicht von seiner eigenen Resonanzlosigkeit auf die Adornos. Das ist aber nicht zutreffend, denn Adorno ist – ein halbes Jahrhundet nach seinem Tod, – noch immer springlebendig als erstklassige Referenz der Fachleute. Meine Vermutung ist, das werde noch lange so weitergehen. – Bach lag ihm offenbar nicht so richtig, aber dennoch hat er sich da ganz gekonnt aus der Affäre gezogen mit einem ein wenig windschiefen Lob – sehr, sehr elegant!
Das mit der Resonanzlosigkeit ist immer so eine Sache. Resonanzlosigkeit bei wem und in welchen Kreisen?
Adornos Nachleben hatte in den 80er Jahren einen Höhenflug und da auch nur in universitär beeinflußten Zirkeln. Ich erinnere mich an ein Konzert mit damals zeitgenössischer Musik in Nürnberg. Ein Stück hieß „Adorno hat gesagt …“ und es thematisierte Adorno als Referenzgröße in nahezu jeder Diskussion auf etwas ironische Art und Weise. Undenkbar jetzt einem Musikstück einen ähnlichen Titel zu geben.
Scrutons Werk sehe ich in keinster Weise als resonanzlos. Seine Leserschaft setzt sich aber wahrscheinlich gänzlich anders zusammen, als die Adornos.
Beide werden immer wieder zitiert werden, zumal die abendländische Kulturgeschichte Zyklen unterworfen ist. Bach ist hierfür das beste Beispiel.
Utopien sind Wunschkonzerte wie Sozialismus oder Kommunismus, vereint unter denm Begriff Faschismus. Weltrevolution und Komintern war damals,heute sind es Transformation und Weltklimarat, letztendlich eine Soße. Die Erkenntnis setzt Lebensjahre voraus, die die neue Elite aus der universitären Inzucht nicht hat. Intellekt sieht heute anders aus, genannt „Praktische Intelligenz“. Die Verwissenschaftlichung des Banalen treibt ihr Blüten . Die Herde eilt im Vollsprint und wartet sehnsüchtig auf den Einschlag.Aber nichts wird kommen . Irgendwie wünschen sich die Katastrophalen dieselbe,nur damit ihre Wahrsager zu Göttern werden.
„Transformation“ ist das Linke“Tarn“Wort für Links-tyrannische Machtrergreifung!
Die Wähler-Schafe sollen nicht erkennen, wie sie diktatorisch entrechtet werden,
sobald die die Links-Grünen über alle Schalthebel der Macht verfügen.
Der Trick mit ihrer „Weltrettung“ dient nur zur moralischen Erpressung durch Schuld-Zuschreibung für das gesamte Volk. Das eingeimpfte Schuldgefühl soll die Massen vom Aufstand gegen die Unterdrückung durch Links-Grüne Tyrannen
moralisch abhalten.
„Transformation“ war, ähnlich wie „Wende“, bis vor 20 Jahren noch überaus positiv besetzt. Was In Ostdeutschland „Wende“ hieß, bezeichnete man in anderen Ex-Osteuropa-Ländern als „Transformacja“. Die gute Bezeichnung für die damalige erfreuliche Entwicklung wurde in D nach und nach umgedeutet und bezeichnet jetzt, genauso wie „Wende“, oktroyierte Verschlechterungen.
Ich bin in der Schule mit Adorno und Marcuse genervt worden. Für mich waren das immer grauenhafte Schwurbler, die unfähig waren, sich halbwegs verständlich auszudrücken. Ne Art von elitärer Arroganz halt. Ähnlich schlimm wie Judith Butler.