Eine Momentaufnahme: ZDF, heute journal, 1. Juli 2018. Ein Bericht über den Koalitionsstreit zwischen CDU und CSU zur Asylpolitik. Darin wird auf Kritik vonseiten »der Bundestagsopposition« eingegangen. Gesendet werden zwei Stellungnahmen: von Politikern der FDP und von Bündnis 90/Die Grünen. Auf Stimmen der anderen Oppositionsparteien wartet der Fernsehzuschauer vergeblich, obwohl Die Linke über mehr Abgeordnete verfügt als die Grünen und die AfD über mehr als die FDP. »Lügenpresse« oder »Fake News«, um zwei Schlagworte zu nennen, kommen Bürgern über die Lippen, die mit der Vorenthaltung von Information nicht zufrieden sind. Doch die Medien kommen häufig ohne direkte Lügen aus, deshalb trifft der ebenfalls in der politischen Kontroverse genutzte Begriff »Lückenpresse« das Phänomen weit besser.
Wahrheit besteht aus der Summe zahlreicher unterschiedlicher Facetten von Wirklichkeitswahrnehmung. Kein Mensch kann alle Informationen aufnehmen, die täglich auf ihn einprasseln. Mechanismen der Wahrnehmungsfilterung sorgen dafür, dass wir nur jene registrieren und verarbeiten, die wir für essenziell erachten. Ähnlich agieren Medien: Sie treffen aus der Fülle an existierenden Informationen eine Auswahl, da es gar nicht möglich ist, sämtliche Facetten eines Sachverhalts oder eines Streitfalls aufzubereiten. Stattdessen werden die Daten auf eine möglichst schnell konsumierbare Größe, eine »Story«, zusammengeschnitten. Im extremen Fall bleibt eine schwarz-weiß gestrickte »Gut-gegen-Böse«-Geschichte übrig. Medienmitarbeiter entscheiden also darüber, welche Information gesendet wird und welche nicht. Und mit welchen Worten die Information vermittelt wird. »Die Wahrheit« erreicht den Leser oder Zuschauer also nur in einer gefilterten Form, nur noch indirekt.
Nun könnte man dies als strukturelle Notwendigkeit betrachten oder auch als ein Serviceangebot der Medien für die Adressaten. Doch stellt sich bei der Informationsfilterung die Frage, nach welchen Kriterien dies geschieht. Welcher Meldung wird eine besondere Bedeutung zugebilligt, welcher Hinweis als minder oder unwichtig erachtet? Letztlich also: Was wird mitgeteilt, und was fällt unter den Tisch? Und ist es eher Zufall oder pure Willkür, wenn bestimmte Informationen verschwiegen, andere hingegen aufbereitet und dramatisiert werden? Im Regelfall ist es doch sehr wahrscheinlich, dass ein Medienvertreter sich bei der Auswahl etwas denkt, vor allem wenn es sich nicht um reinen Broterwerb, sondern um eine faktisch ehrenamtliche Tätigkeit handelt wie bei Wikipedia. Vermutlich wird bei Letzterer eine höhere oder eine persönliche Absicht verfolgt – entweder aktiv, indem versucht wird, den Leser in dessen (politischer) Haltung zu beeinflussen, oder passiv: Der Medienmitarbeiter ordnet sich, zum Beispiel aus Karrieregründen, einer Mehrheitsansicht unter, spielt also ein gelerntes Spiel aus opportunistischen Gründen mit.Bei Journalisten klassischer Medien im deutschsprachigen Raum ist nun eine starke Sympathie für politisch linke Positionen nachgewiesen, so auch in der Bundesrepublik. Laut einer 2013 veröffentlichten Umfrage gaben Politikjournalisten folgende Parteipräferenzen an: keine Partei 36,1 Prozent, Grüne 26,9 Prozent, SPD 15,5 Prozent, CDU/CSU 9 Prozent, FDP 7,4 Prozent, Die Linke 4,2 Prozent, Sonstige 0,9 Prozent. Focus schrieb dazu:
»Bei einer Wahl, bei der die Unparteiischen als Nichtwähler zu Hause blieben, ergäbe sich somit folgende Stimmverteilung: Grüne 42 Prozent, SPD 24 Prozent, CDU/CSU 14 Prozent, FDP zwölf Prozent, Linke sieben Prozent. Die Kollegen votieren also mit einer satten Zweidrittelmehrheit für die neue Bundeskanzlerin Claudia Roth und wählen die SPD als Juniorpartner in einer grün-roten Koalition.«
Dies unterscheidet sich eklatant von den Ergebnissen der letzten Bundestagswahlen, d. h., es existieren bezüglich der politischen Auffassungen deutliche Differenzen zwischen der Berufsgruppe der Journalisten und der Gesamtbevölkerung. Auch daraus erklären sich Filterungen wie die anfangs erwähnte im heute journal. Vor allem erklären sich Unterschiede und Entfremdungen hinsichtlich der Wirklichkeitswahrnehmung vieler Bürger und der Wirklichkeitsdarstellung vieler Medienvertreter.
Nun gibt es keine Umfragen zur politischen Präferenz bei Wikipedia-Autoren. Zu vermuten ist aber, dass hier eine ähnliche Schlagseite nach links vorliegt. So zumindest lautete das Resultat einer Erhebung der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Dort wertete man 2010 eine Umfrage unter deutschen Wikipedia-Administratoren aus. Von 281 Anfragen kamen 56 Rückantworten. »Der typische Administrator in der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist täglich 140 Minuten auf der Plattform aktiv, männlich, 40 Jahre alt und linksliberal«, schrieb Torsten Kleinz auf heise online.
Von 28 kategorisierten Angaben stuften sich fünf Administratoren als »links« ein, zwei als »eher links«, vier als »Mitte-links«, fünf als »linksliberal«, zwei als »grün«, einer als »links-grün«. Hinzu kamen einer, der sich als »pragmatisch-grün« bezeichnete, zwei »Liberal-Grüne«, fünf »Liberale«, ein »Libertärer« und einer, der sich der »Mitte« zugehörig fühlte. Selbsteinstufungen als »rechts« oder »konservativ« gab es nicht eine einzige. Einige Administratoren machten ausformuliertere Angaben, ein einziger nannte sich »konservativ, sozial, heimatverbunden, umweltorientiert, Wirtschaftsfreund, Globalisierungskritiker, am Christentum zweifelnd, islamkritisch, kapitalismusskeptisch«. Andere verorteten sich als »tendenziell eher links«, als »links der Mitte in variierender Ausprägung«, als »am ehesten wohl linksliberal« und einer als »wertkonservativer linksliberaler grüner Sozialist«.
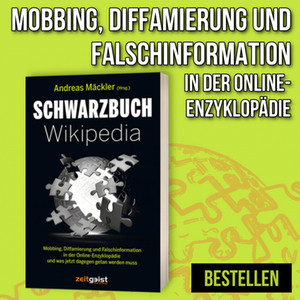
Zugleich ist die Befürchtung einer Veränderung des Stimmungsklimas oder gar einer »Unterwanderung« durch rechtsgerichtete Autoren vor allem eine Sorge derjenigen, die sich der Linkslastigkeit in der Administratorenschaft – und sehr wahrscheinlich auch in der Autorenschaft – bewusst sind, diese Dominanz begrüßen und durch Appelle an die Wachsamkeit abzusichern suchen. Infolge der solcherart ausgeübten Macht über die Darstellung auf Wikipedia-Seiten werden zum einen die Leser in ihrer Haltung zu bestimmten Positionen, Personen und Institutionen beeinflusst, und zwar umso mehr, je unkritischer sie gegenüber Medien sind, zum anderen kann Personen, von denen Einträge handeln, direkt geschadet werden: beruflich, wirtschaftlich und persönlich.
Methoden der unterschiedlichen Darstellung in Wikipedia-Beiträgen
Wie werden Auswahl, Gewichtung und Wertung von Wirklichkeit nun aber bei Wikipedia umgesetzt? Nachfolgend werden drei Taktiken vorgestellt, die allesamt den gezielten Einsatz bzw. das Weglassen von Informationen nutzen. Medienwissenschaftler sprechen von »Framing«: Bestimmte Worte wecken bestimmte Assoziationen und Einstellungen. Die nachfolgend stichprobenartig herausgesuchten Beispiele sollen dazu dienen, für das Problem zu sensibilisieren.
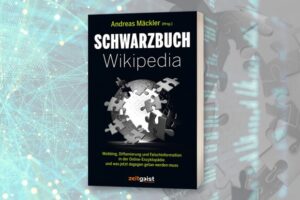
Wikipedia: Manipulationen Orwell‘schen Ausmaßes
a) Kategorisierung vs. Unterlassen von Kategorisierung
Menschen neigen bei der Verarbeitung von Eindrücken zur Einordnung, zum »Schubladendenken«. Problematisch werden von außen gesetzte Kategorisierungen, wenn damit politische Affekte generiert bzw. Vorurteile geschürt werden. Eine solche Absicht kann hinter einigen Wikipedia-Artikeln zumindest vermutet werden. Die These lautet: Besteht Interesse, eine Person oder eine Institution für einen Teil der Leser als von einseitigen politischen Interessen geleitet zu »brandmarken«, dann setzt man dort ein »Brandzeichen«: Sie werden politisch festgelegt, einer Partei zugeschrieben, oder es wird zumindest ein Feld umgrenzt, in dem sie sich bewegen. Möchte man eine Person oder Institution hingegen als möglichst seriös, aufgeklärt, rational, der Wissenschaft verpflichtet darstellen, so wird auf eine Kategorisierung verzichtet.


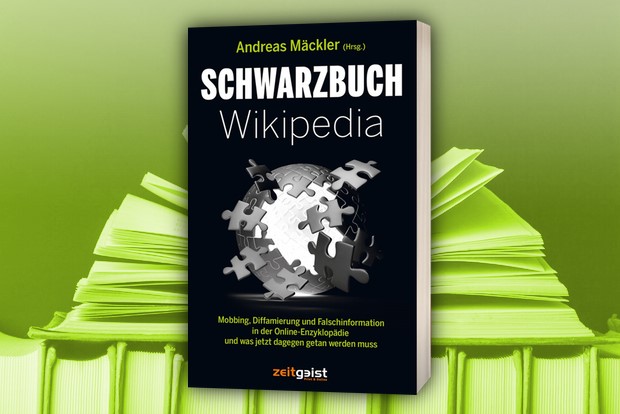

Es gibt in Wahrheit überhaupt KEINE linke, rechte, konservative, sozialdemokratische, liberale oder sozialistische…
.. Mathematik(!) ,..
.. denn Demographie ist in Wahrheit lediglich NUR angewandte Mathematik!
Und die Migrationswelle wurde aus dem einfachen Grund exakt im Jahre 2015 ff in Richtung Mitteleuropa, insbesondere jedoch Richtung Deutschland ausgelöst, weil erst die deutschen Geburtsjahrgänge 1949 ff als deutsche Rentnerjahrgänge dauerhaft stärkemässig größer ausfallen, als 66,66(1,4:2,1) Prozent der jeweils 48(28+20) jährigen, die selbst als Geburtsjahrgänge 1994 in den Jahren 2014 ff dauerhaft auf dem deutschen Arbeitsmarkt eintreten werden!
Und da ja alle anderen alteuropäischen Völkerschaften bei einer annähernd gleichbleibenden TFR von 1,4 im Verhältnis zu 2,1 ebenfalls wie wir Deutschen folgende Generationsreihenfolge..
100,00 , 66,66, 44,44, 29,63, 19,75..
.. haben, müssen halt wohl notgedrungen die zumeist nichteuropäischen Ersatzenkel auf den deutschen Arbeitsmarkt ran, deren Tarnmame ich bedauerlicherweise inzwischen vergessen habe!
Wenn Sie eine Parteiendemokratie wie der unsrigen eine extrakonstitutionelle Notstandsmassnahme zur Abarbeitung zuweisen, führt dieser aufgrund der absoluten Unvereinbarkeit von Parteiendemokratien und extrakonstitutionelle Notstandsmassnahmen immer einen vollständigen kleptokratischen Umsturz durch!
Der absolut maßgebliche Punkt dabei ist, daß AUSNAHMSLOS sämtliche juristischen Personen, einschließlich unserer bestehenden Rechtsordnung, Ersatzenkelstampeden aus rein demographischen Gründen genannt Flüchtlingskrisen zur Verhinderung eines ansonsten sicheren demographischen einhergehenden gesellschaftlichen Zusammenbruch von Drittstaaten aufgrund der fortgesetzten Kinderlosigkeit der eigenen Bevölkerung bis zum heutigen Tagein Wahrheit überhaupt NICHT kennen,und diese auch niemals kannten!
Denn gibt es zwischen der Behauptung „Flüchtlinge“ und der Behauptung „zumeist nichteuropäische Ersatzenkel genannt Flüchtlinge“ auch nur den geringsten Unterschied, dann ist es hier in Deutschland zu einer massiven Ungleichgewichtung ALLER politischen Parteien innerhalb der deutschen Parteiendemokraten gekommen, die jedoch unbedingte Voraussetzung für die Existenz einer jeden Parteiendemokratie ist!
Aufgrund dieser massiven Ungleichgewichtung ist in Wahrheit die gesamte Parteiendemokratie hier Deutschland allerspätestens seit dem Jahr 2015 ff vollständig und auch dauerhaft gescheitert!
Und zwar ausdrücklich NICHT, weil alle anderen politischen Parteien außerhalb der politischen Partei AfD schon irgendwie immer FÜR Ersatzenkelstampeden waren, sondern weil diese Ersatzenkelstampeden schlichtweg einfach überhaupt nicht kannten!
Freue mich, daß tichyseinblick einem der „Stammautoren der Jungen Freiheit“ (Wikipedia) publizistisch Raum gibt. Ich würde mir nur noch wünschen, daß dann Artikel wie die neulich von Th. Meyer gegen die bösen Flügelleute von der AfD ersetzt würden durch eine sachliche Berichterstattung. Und würde mir noch wünschen, daß Sie – nachdem viele Beiträge zu den Artikeln von Th. Meyer zensiert wurden, die gewohnte Freiheit, hier zu schreiben, wieder herstellen. Und daß Sie, verehrte Redaktion, DIESES Statement mal nicht zensieren. Bitte Gedankenfreiheit.
Ja WiKi, da kommen bei mir fast nostalgische Gefühle auf. Eine meiner Stammquellen wenn es um Persönlichkeiten, Begriffe, wirtschafltliche oder geschichtliche Zusammenhänge usw. ging. Ging wohlgemerkt, heute fasse ich WiKi nur noch selten an, ist mir zu linkslastig, vergrünt und alles andere als eine neutrale Informationsquelle. Schon gar nicht wenn es um Politik, Umwelt, Klima und was dazugehört geht, jeder kann den Test machen und einfach mal ein paar Schlagwörter nachsehen z.B. Klimaskeptiker. Was da geboten wird hat mit irgendwelchen Wissenschaften nichts aber auch gar nichts zu tun. Das ist pure Propaganda! Nachdem ich folgendes Video
https://www.youtube.com/watch?v=wHfiCX_YdgA
gesehen habe machte ich einen Test. Ich veränderte die Texte nur ganz leicht und ob man es glaubt oder nicht, innerhalb von Minuten waren meine Änderungen gelöscht und da ich es weiter versuchte wurde ich gesperrt.
Fazit. Wenn ich genau wissen will wann Pythagoras gelebt hat oder wie lange der dreißigjährige Krieg dauerte(kleiner Scherz) dann benutze ich WiKi ansonsten laß ich die Finger von.
Ps. Ich finde es immer lustig wenn sich Leute mit ihren wirren Ansichten ausdrücklich auf WiKi als Quelle beziehen da ist es meißt mit der Bildung nicht weit her.
Einen herausragenden Verhaltensforscher sucht man z.B. in der deutschen Wikipedia vergebens: Daniel G. Freedman.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?cirrusUserTesting=control&search=Daniel+G+Freedman&title=Spezial%3ASuche&go=Artikel&ns0=1
Seine langjährige Wirkungsstätte, die Universität von Chicago, listet sein umfangreiches Werk zur vergleichenden Verhaltensforschung und Sozialbiologie.
https://news.uchicago.edu/story/daniel-g-freedman-1927-2008
Die englische Wikipedia belässt es bei einem knappen Eintrag und zeitweilig konnte ich diesen in den letzten Jahren auch nicht aufrufen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_G._Freedman
Es hat wohl etwas damit zu tun, dass Freedman sich mit biologischen Rassenunterschieden beschätigt hat und dabei Videomaterial bereitsstellte, dass den dogmatischen Antirassisten (gerade den Wikipedianern) den Atem verschlug.
Ich empfehle den Youtube-Kanal Geschichten aus Wikihausen
Aktuelles Beispiel ist der Wiki Beitrag über Christian Drosten. Sage nur Gutes über ihn
scheint das Motto zu sein. Seine fragwürdige Rolle während der Schweinegrippe 2009
oder der danach folgenden Vogelgrippe, wird mit keinem Wort erwähnt.
Der Mann von Gesundheitsminister Jens Spahn, der Journalist Daniel Funke, Chef-Lobbyist der Hubert Burda Media und zuvor Leiter des Berliner Hauptstadtbüros der Zeitschrift Bunte, hat gar keinen Eintrag – wiewohl „Verbindungen“.
Und noch eine Anmerkung zu den „Leit oder Leid“-Medien:
Ein Todesopfer durch die Polizei in den USA – so traurig, niederträchtig und verabscheuungswürdig die Tat auch ist – ich würde auch dagegen demonstrieren – ist den Tagesschauen unseren Landes, mit allen Bildern drum und dran, wieder und wieder, tagelang die erste Meldung wert, dadurch noch begünstigt, dass der Präsident jetzt Trump heißt und nicht mehr Obama. Von einem Messeropfer im eigenen Land erfährt man, wenn überhaupt, in einem Zeitungsartikel ganz unten. Oh wie weit sind wir gesunken.
Zitat: „. Von einem Messeropfer im eigenen Land erfährt man, wenn überhaupt, in einem Zeitungsartikel ganz unten“
> Auch von den hier bei TE geschilderten Steine werfenden Vorfall in Dietzenbach, war beim Reg-Funk, ntv und WELT bis heute nix zu hören. Statt dessen stündlich Berichte über u.a Steine werfende Krawallos in den USA und Gehetze gegen Trump. Über auf Polizisten und Hilfskräfte Steine werfende bunte „Fachkräfte“ in Deutschland schweigen unsere Qualitäts- und Reg.-medien lieber -besonders auch dann wenn sie bunt sind!
Dietzenbach ist meinen inzwischen erblindeten und damit auf die Anstalten angewiesenen Kollegen aufgefallen – er wunderte sich, weil die Berichterstattung so abrupt abbracht – wiewohl ihn interessiert hätte, was genau vorgefallen ist.
Der Gewerkschafter, der am Rande einer Demo in Stuttgart ins Koma geschossen wurde, ist auch aus den Medien verschwunden – inwieweit darüber berichtet wird, dass in Stuttgart am Haus der Gewerkschaft ein Spruchband ausgerollt wurde – entzieht sich meiner Kenntnis: https://twitter.com/IBDeutschland/status/1266752047501713410
Die Schlafmichel wissen davon nichts – und träumen weiter davon, dass nur in den USA riots auf den Straßen ihr Unwesen treiben.
Wir finden nur, wenn wir um Vorfälle nicht vergessen und weiter suchen.
Toll, dass Sie die üblen Täuschungsmanöver der Möchtegern Kommunisten (Tricks kann man dazu nicht mehr sagen) auseinandernehmen und sichtbar machen.
„…deshalb trifft der ebenfalls in der politischen Kontroverse genutzte Begriff »Lückenpresse« das Phänomen weit besser.“ Finde ich nicht das „Lückenpresse“ besser trifft. Die Absicht zählt. Und die Absicht dieser „Sich selbst bestätigen Wollenden“ ist nun mal dem Leser eine verfälschte Information unterzujubeln UM EIN BESTIMMTES; IHNEN NUTZENDES RESULTAT ZU ERREICHEN. Gerne zum Schaden des Nicht Imformierten. Das nennt sich nun mal Lüge. Das geht ja inzwischen bis zum komplett umdrehen des Inhalts. Plus Rufmord, plus Diffamieren.
Ja, das sehe ich im Grunde auch so wie!von Ihnen geschildert. Denn auch wenn in einen Artikel/Bericht zB „nur“ etwas gewollt weggelassen oder nicht berichtet wird, handelt es sich hier dann auch für mich um eine vorsätzliche Lüge um zu täuschen und irre zu führen.
Doch im Grunde auch egal ob unsere Qualitätsmedien dann bspw als Lücken- Verschweig- oder „wie-auch-immer-Presse betitelt wird. Im Innersten denkt und weiß dann doch jeder von uns das damit vor allem auch Lügenpresse gemeint ist.
TRIVIALISIERUNG DER WISSENSCHAFT
Überall ist zu viel Gefühlsschmonzes drin. Meine Theorie: das Ganze ist eine Folge der zunehmenden Verweiblichung der Gesellschaft und der Überbetonung nicht messbarer Sachverhalte wie „social skills“ („sozialer Intelligenz“, fast schon ein Oxymoron, zumindest ein Synonym für „Einschleimen“). Individuelle, kognitive Intelligenz kann man einigermaßen reliabel messen, nicht aber das, was als soziale Intelligenz bezeichnet wird.
Neutralität und Sachlichkeit werden vom wildgewordenen Feminat (das zunehmend die Lufthoheit über den linksgrünen Lindenstraßen-Stammtischen erobert hat) als inhuman hingestellt. Plastisches Beispiel: einer der letzten ÖR-Journalisten mit Format, HaJo Friedrichs, hat einen berühmt gewordenen Ausspruch geprägt (sinngemäß zitiert): „Ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer vermeintlich guten.“ Das sind natürlich goldene Worte, sie sollten in Stein gemeißelt vor jeder Redaktionsstube zu lesen sein.
Nun ging vor einiger Zeit eine Frau, Berufskollegin des verblichenen Herrn Friedrichs hin und kippte genau diesen Ausspruch, indem sie sagte „Zeit sich mit der guten Sache gemein zu machen.“ Und was gut ist, das entstammt der realitätsfernen Vorstellungswelt ihres linksgrünen Wolkenkuckucksheims, ihrer Verwöhntheit und dem bourgeoisen Kokon ihres Umfelds.
Es sind nicht mehr Leute wie HaJo Friedrichs, die den Ton angeben, es sind weltfremde Schneeflocken, die sich anhand folgender Adjektiven charakterisieren lassen: verwöhnt, überdreht, verzogen, verweichlicht, zimperlich, verhätschelt, anmaßend, dünnhäutig, weibisch, muttersöhnchenhaft, naiv, etc. etc.
Die Welt ist nicht so wie die Schneeflocken, und es ist Zeit, denen ihre Grenzen aufzuzeigen. Ihnen klar zu machen, dass sie Resultate zivilisatorischer Fehlentwicklungen sind.
Was Sie „Verweiblichung“ nennen ist meiner Meinung nach das „Bauchgefühl“, das uns seit den 68igern eingehämmert wird, das dieses das Non Plus Ultra sei bei den Entscheidungen. Doch das Bauchgefühl kennt nur: Sich wohlfühlen wollen und Unangenehmes vermeiden. Genau die Problematik, die wir in unserer Gesellschaft haben. Im Extrem die Schneeflöckchen Generation, die „Gutmenschen“ und in der Politik der Verlust der Fähigkeit auch mal unangenehme aber richtige Entscheidungen zu treffen. „Haltung“ statt Denken. Unter dem Mäntelchen der „Toleranz“ immer weiter zurückzuweichen (der bequemste und konfliktärmste Weg ).
Deshalb müssen auch andere an Wikipedia spenden. Ich bleibe Nutzer, mit kritischer Distanz.
Mit Halbwahrheiten wird seit Jahren öffentliche Meinung manipuliert. Aktuell: die Grund rente für Alle. Immer wieder die geschiedene Frau, die jetzt Armutsrentnerin ist. Nie erwähnt wird, dass 1977 im Scheidungsrecht der Versorgungsausgleich verankert ist. Noch weniger wird erwähnt, dass jedes Kind Rentenpunkte bringt. Die Deutschen haben wesentlich weniger Kinder als bildungsferne Migranten.
Aktuelles Beispiel: Übernahme der Altschulden von Kommunen. Ein Wahlgeschenk der SPD. Die SPD war es, die mit ihren Hartz IV Gesetzen den Kommunen die Hauptkosten, z.B. Wohnkosten, für Hartz IV Empfänger aufbrummte.
jeglichen politischen Artikel der wikipedia sollte man mit der Kneifzange anfassen.
Mit einem Teil dieser Aktivitäten wird das Prinzip der NGOs als „Nicht-Regierungs-Organisationen“ ad absurdum geführt, in dem Regierungen diese NGO durch Geld finanzieren, aber einer demokratischen Kontrolle entziehen. Damit werden die Medien „gelenkt“ und die Demokratie untergraben. Kein Wunder, dass kritische Geister diesen Kanälen immer weniger Glauben schenken.
Die Leute, die in der wikipedia tätig sind, sind eher als politische Aktivisten anzusehen. Das Editieren von diesen Inhalten kommt eher dem Schreiben von Texten mit Word nahe und ich würde es höchstens wegen leicht autistischen Einschlages als „Nerd“ oder INCEL-Symptom ansehen wollen.
BZW: Ein Computer-Nerd beschäftigt sich mit echter Hard- oder Software als eher als Programmierer oder Hacker.
Meine Erfahrungen als einstiger Wikipedia-Autor: In den Themengebieten Geschichte und Politik ist dieses Projekt, das gerne eine Enzyklopädie wäre, die reinste Propagandaschleuder. Wer wissen will, wie perfide es dort hinter den Kulissen abläuft, sollte sich die Doku „Die dunkle Seite der Wikipedia“ ansehen.
In einer Enzyklopädie, in der der Spiegel als valide Quelle gilt, gelten Friseure auch als Hirnchirurgen. (frei nach Wiglaf Droste)
„Nach den Jahren des Aufbruchs haben die meisten Autoren der Wiki-Community längst den Rücken gekehrt. Die einstige Idee des kollektiven Wissens wird heute von einer überschaubaren Clique untereinander heftig zerstrittener, provinzieller Streithanseln dominiert, die ihre Intriganz allenfalls dann überwinden, wenn es gegen Leute von außen geht.“ (Markus Kompa)
Viele Artikel auf Wikipedia sind erschreckend einfältig und biedere deutsche Hausmannskost. Oder „like Kaffeekränzchen“. Schon das stößt mich ab. Die Hintergründe der Schlagseite zu kennen ist zwar interessant, aber auch ohne dem widert die linke Propaganda und Hetze derart an, dass ich mir die Nutzung dieser vermeintlichen Enzyklopädie so gut wie immer sparre.
Auf die politische Ausrichtung habe ich noch nicht geachtet, nutze aber die Wiki so selten als möglich. Zum einen aus Misstrauen über die Qualität. Zum anderen ist die Wiki nicht zitierfaehig, weil sie ja jeder hat, man kann sich damit nicht mehr abgeben.Paradoxerweise ist sie daher heute fast wertlos.