Globalisierungskritik ist populär. Und gerade jetzt in der Corona-Krise erhält sie neuen Zulauf. Moralisch kann man sich leicht über schlechte Arbeitsbedingungen in Bangladesch oder Indien empören. Und sich über die Schweinehälften oder Südfrüchte echauffieren, die Tausende von Kilometern transportiert werden. Subtiler ist es schon, wenn die regionale Vermarktung von Produkten oder die Autarkie bei der Rohstoff- oder Energieversorgung oder jüngst bei Medikamenten und Atemschutzmasken gefordert wird. Dahinter steckt dann meist die Vorstellung von der Demokratisierung von Wirtschaftsprozessen. Nicht mehr der Kunde soll darüber entscheiden dürfen, ob er seinen Apfel vom Bauernhof nebenan oder als Importprodukt aus Übersee im Supermarkt kauft, sondern eine von der Regierung gestaltete Politik soll diesen Prozess ersetzen – koste es, was es wolle. Und zwar, weil es das Richtige ist. Das Gute.
Dies führt letztlich zur Aushöhlung des Eigentums und damit zum Wegfall der Grundlage unserer Wirtschaftsordnung, der Marktwirtschaft. Formal sind die Unternehmen zwar noch in privater Hand, doch faktisch lenkt der Staat das Geschehen. Dessen Vertreter in Parlament und Regierung glauben besser zu wissen, was nachhaltig ist. Nachhaltigkeit wird so, wie es Friedrich-August von Hayek einmal über den Begriff „soziale Gerechtigkeit“ formuliert hat, zum neuen „Wieselwort“. Es ist einfach nicht zu packen.

Grüne: Wohin geht die Reise mit Habeck und Baerbock?
Diese Entwicklung und das dahinterstehende Misstrauen gegenüber dem Individuum ist nicht neu. Doch dagegen muss man eine laute Stimme erheben. Wachstum ist ein Segen, weil er die Voraussetzung für den ökonomischen Aufstieg von Milliarden Menschen auf dieser Welt ist: “Je höher der Grad der wirtschaftlichen Liberalisierung in einem Land ist, desto größer ist die Chance auf mehr Wohlstand, schnelleres Wachstum, höheren Lebensstandard und längere Lebenserwartung“, schreibt der schwedische Ökonom Johan Norberg.
Oft wird die Vergangenheit und der Zustand der Menschheit vor hunderten von Jahren verklärt. Wer heute Spielfilme schaut, die vor 100 oder 200 Jahren spielen, der bekommt häufig den Eindruck, dass das Leben damals auch seinen Reiz hatte. Doch der Wilde Westen oder die Seefahrerromantik hatten in Wirklichkeit nichts Reizvolles.
Am Ende des 18. Jahrhunderts mussten normale französische Familien ungefähr ihr halbes Einkommen nur für Getreide aufwenden. Franzosen und Engländer im 18. Jahrhundert nahmen weniger Kalorien zu sich als derzeit der durchschnittliche Mensch in Subsahara-Afrika. Katastrophale hygienische Verhältnisse, Hunger, Seuchen und Tod waren damals normal. Ein Großteil der Bevölkerung kämpfte tagtäglich buchstäblich ums nackte Überleben.
Auch damals gab es wie heute Skeptiker. Robert Malthus hatte Ende des 18. Jahrhunderts sein berühmtes Bevölkerungsgesetz aufgestellt. Darin behauptete er, dass die Bevölkerung in einer geometrischen Reihe, die Nahrungsproduktion aber lediglich in einer arithmetischen Reihe wächst. Es sei eine Frage der Zeit bis die Menschen sich nicht mehr selbst ernähren könnten. Die These war damals populär, weil die Bevölkerung durch die Industrielle Revolution wuchs und die Menschen in die Städte zogen, wo es Arbeit gab. Das Malthussche Gesetz erwies sich aber als grundfalsch. Moderne Anbaumethoden, Schädlingsbekämpfung und die Technisierung in der Landwirtschaft bewiesen das Gegenteil und ermöglichen heute die gesunde Ernährung von vielen Milliarden von Menschen.
Dennoch ist in jüngster Zeit die These immer noch populär. Der Club of Rome trat in den 1970er Jahren in die Malthusschen Fußstapfen und prognostizierte die Grenzen des Wachstums. Und noch heute glauben und verbreiten die Globalisierungsgegner von links und rechts diese. Es darf halt nicht sein, was nicht sein kann.
Zu Zeiten Robert Malthus‘ lebten 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt. Heute sind es 7,6 Mrd. Menschen. Bis zum Jahr 2050 werden nach Prognosen der Vereinten Nationen voraussichtlich 9,8 Milliarden Menschen leben, bis zum Jahr 2100 womöglich sogar 11,2 Milliarden.
Neben der Ernährungsfrage der Menschheit kommen Umwelt- und Klimafragen hinzu. Viele dieser Untergangsapologeten meinen, ohne einen Verzicht der Menschen nicht einmal nur in den wohlhabenden Ländern und ohne eine radikale Veränderung der bisherigen Gewohnheiten in den Bereichen Ernährung, Mobilität und Lebensstandard sei die Welt nicht zu retten. Weltuntergangsstimmung macht sich breit.

Was der Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt wirklich braucht
Durch die Arbeit des Agrarwissenschaftlers Norman Borlaug ist die Züchtung von Saatgut gelungen, das parasitenresistent und weniger abhängig von Sonneneinstrahlung war. Die Ernten in einer trockenen Region wie Mexiko versechsfachten sich von 1944 bis 1963, und das Land wurde beinahe über Nacht zu einem Weizenexporteur. Für seine Arbeit bekam Borlaug 1970 den Friedensnobelpreis, weil er dadurch Milliarden Menschenleben gerettet hat. Aber nicht nur das: er rettete durch seine Entwicklungen auch viele Tiere und Pflanzenarten. Millionen von Hektar Wald hätten abgeholzt werden müssen, wenn er das leistungsstärkere Saatgut nicht entdeckt hätte. Der Waldverlust hat sich seit den 1990er Jahren von 0,18 auf 0,008 Prozent verkleinert. Im Amazonas hat die jährliche Abholzungsrate seit 2005 um 70 Prozent abgenommen.
Dank besserem Waldschutz und höherer Ertragszahlen auf den Flächen der Landwirte, durch besseres Saatgut und bessere Anbaumethoden konnte dieser tatsächliche „Große Sprung nach vorn“ erreicht werden. Wachstum und Umweltschutz sind keine Widersprüche, sondern bedingen sich. Sie setzen Fortschritt und technologische Offenheit voraus. Der Irrglaube der Globalisierungskritiker besteht darin, dass sie Wachstum nur quantitativ betrachten und nicht qualitativ. Wachstum verändert sich aber mit steigendem Wohlstand, weil sich die Präferenzen der Menschen mit zunehmender Lebensqualität verändern. Nicht „immer mehr“ ist das Ziel, sondern „immer besser“. „Immer besser“ gilt auch für die Umwelt. Die technische Entwicklung von Filtern, Reinigern, effizienteren Anlagen und Motoren ist nur mit Wachstum und Wohlstand möglich. Und hinzu kommt: nur der Kapitalismus kann dies auch finanzieren. Dem Sozialismus geht dabei immer das Kapital aus. Daher gilt: Verzicht, staatliche Verhaltenslenkung der Bürger oder das Zurückdrehen der Globalisierung schafft nicht weniger Armut, nicht weniger Hunger und Elend, sondern mehr. Der Fortschritt, die Marktwirtschaft und die Globalisierung sind die Garanten dafür, dass immer mehr Menschen in Wohlstand leben können. Denn es gibt kein Ende des Wachstums, wenn die Menschen auf dieser Welt vernünftig bleiben und den Apologeten des Untergangs nicht auf den Leim gehen. Das Leben wird immer besser – heute, morgen und in der Zukunft.
Dieser Beitrag ist in leicht geänderter Form als Vorwort im gerade erschienen Buch von Johan Norberg „Fortschritt – Ein Motivationsbuch für Weltverbesserer“ , Edition Prometheus, Finanzbuchverlag erschienen.


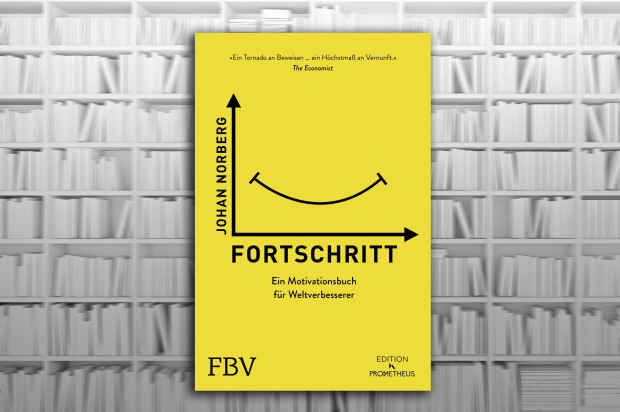

Händler haben schon immer die Ecken der Welt durchstreift und Waren aus allen Reichen zu ihren Kunden gebracht, siehe Marco Polo nur als ein Beispiel. Nur hat man nie grundlegendes für ein Reich outgesourct. Globalisieren kann man ja, nur sollte das mit Augenmaß erfolgen. Wir sehen, was es uns eingebracht hat, sehr viel nach China auszulagern. Dazu muss man auch sehen, dass Arbeiten auch eine Tradition habe muss, um Produkte mit hoher Qualität anbieten zu können. Das geriet aber völlig aus dem Blick. Wir werden mit Billigwaren überschwemmt. Jedes kleinste Fitzelchen kommt heutzutage aus China. Das ist kein gesundes Wirtschaften. Des Weiteren ist es unmöglich, dass unsere Arbeitnehmer mit Arbeitnehmern von irgendwo konkurrieren. Auch hier sehen wir heute die Auswirkungen, die gnadenloses Globalisieren mit sich bringt. Die Löhne der Arbeitnehmer hier wurden rapid nach unten gedrückt, was zur Folge hat, dass sich die Arbeitnehmer nur noch Billigkram kaufen können und das wiederum von China importiert wird. Großartiger Fortschritt mit Billigkram kann so nicht entstehen. Nimm ein Rädchen aus dem Spiel und schon fällt das ganze Gebäude zusammen. Es ist auch außer Acht gelassen worden, dass wirklich wichtige Dinge national gelassen werden müssen, vielleicht noch europaweit. Die Situation heute ist, dass wir uns von bestimmten Ländern völlig abhängig gemacht haben und die im Prinzip uns die Pistole auf die Brust halten können. Habe das gerade gelesen, dass Frankreich jetzt zugestimmt hat auch Huawei in Punkto 5G mit einzubeziehen. Und warum? Weil China gedroht hat, Vergeltungsmaßnahmen zu starten, wenn Frankreich nicht nachgibt. Und seien wir mal ehrlich. Welthandel hat es auch vor der Globalisierung gegeben. Länderübergreifende Projekte auch. Diese heutige Globalisierung ist nur ein Abgreifen unserer Gelder und die Verarmung Europas. Wirklich wichtige Dinge, werden immer noch national z.B. in den USA, mit geklauten Know How in China und in Israel entwickelt. Der Rest der Welt wird mit irgendwelchen Tinnef abgespeist.
Aber was genau kann die »Globalisierung« für den Schwachsinn unserer Eliten?
Hr. Schaeffler,
ich bin auch Globalisierungskritiker, sehe mich aber null getroffen oder angesprochen. Irgendwie scheinen Sie einen eingeschränkten Blick zu haben.
Kern meiner kritischen Sicht ist vor allem der Freihandel. Denn früher war der Freihandel ein Wohlstandstreiber – nämlich zu Zeiten, als nur hochwertige und/oder lokal nicht vorhandene Produkte gehandelt wurden. Dadurch gab nur geringen Druck auf lokale Wertschöpfungsketten. Und das lag daran, daß Transport teuer war; es wurde nur transportiert, was sich lohnte, über weite Strecken zu transportieren. Gerade mit dem Aufkommen des Standard-Containers und den Container-Riesen-Frachtern wurde Transport jedoch spottbillig und entfiel als Kostenfaktor. Damit kam Druck auf lokale Wertschöpfungsketten und selbst der kleine Mann stand auf einmal in Internationaler Konkurrenz. Gleiches galt für D mit der EU-Osterweiterung.
Dies ist eine Schattenseite der Globalisierung, die den reichen Volkswirtschaften schwer zu schaffen machte und macht (Arbeitslosigkeit, Niedriglohnsektor etc.), da nun mal nicht jeder Ingenieur oder Facharbeiter werden kann. Und es kann auch nicht jeder einen Job abbekommen, der durch Steuergeld und auf Pump finanziert wird (auch wenn RRG seit Jahrzehnten eifrig daran arbeiten).
Und damit ist an dieser Stelle die Globalisierung leider nur Garant dafür, daß in Niedriglohnländern mehr Leute in Wohlstand leben können – hierzulande war und ist das Gegenteil der Fall.
Die passendere Überschrift wäre gewesen: Der Wirrglaube des F. Schäffler.
Was hier abgeliefert wird, ist ja buchstäblich die Karikatur eines sog. Liberalen, der sich so weitgehend in den Fängen seiner eigenen Ideologie (die er selbstverständlich nicht als solche erkennt, weil Ideologen sind nur die anderen und Liberalismus ist der natürliche Zustand) verfangen hat, dass er die Realität schon lange nicht mehr wahrnehmen kann.
Naja, nicht nur die. Sondern ein paar Superreiche die mit ihren Konzernen die Völker gegeneinander ausspielen können, Gesetze nach ihren Vorstellungen kaufen können, sich über alle Regeln hinwegsetzen können und durch maximale Ausbeutung ihrer Arbeiter jeden Tag Geldmengen anhäufen, die ein normaler Mensch in einem Leben nicht ausgeben kann. Schon früher konnten Staaten kaum diese Fehlentwicklungen unter Kontrolle bringen. Dank der Globalisierung sind die Staaten, die Völker die Beute der Konzerne und anderer Konglomerate von Superreichen.
Das hat mit freiem Unternehmertum nichts mehr zu tun. Wer eine gute Idee hat und sich Startkapital erbetteln kann wird entweder irgendwann aufgekauft oder anderweitig vom Markt geworfen (der Gesetzgeber hilft gern weiter), sofern er ein störender Konkurrent für einen Konzern wird.
Der Mittelstand ist das worauf unser Wohlstand basiert. Er bringt die Menschen in Lohn und Brot, treibt die Innovation, liefert direkt wie indirekt die Steuergelder und ermöglicht einem Staat/Gemeinwesen gewisse Probleme überhaupt angehen zu können. Aber er wird von allen Seiten ausgepresst und attackiert.
»die Völker gegeneinander ausspielen«, »Gesetze nach ihren Vorstellungen […]«, »sich über alle Regeln hinwegsetzen«, »durch maximale Ausbeutung ihrer Arbeiter jeden Tag Geldmengen anhäufen, die ein normaler Mensch in einem Leben nicht ausgeben kann«
Diese von Ihnen beschriebenen Subjekte (»ein paar Superreiche«) tun aber doch nichts anderes als das, was früher Kaiser, Könige und Fürsten auch gemacht haben. Was hat sich also geändert? Und warum sollte das jemals anders sein?
Das stimmt. Es wird erst anders, wenn der Einzelne sich selbst mit allem was er braucht versorgen kann. Technologie mag uns das irgendwann ermöglichen.
Eine bewußt hysterisierende romantische Horde redet in fast verbrecherischer Weise die westliche demokratische Gesellschaftsordnung pauschal schlecht. Hier herrscht der „Gruppenegoismus“ im „Wohlfühlmäntelchen“ und dessen moralischer Überbau, der Kampf für „höhere Werte“ jener Gesellschaftsingenieure, deren romantische Hordenmoral geht bis auf Heraklit zurück: „Je größer der Fall, desto größer der Ruhm“, oder gehöre zu den „Massen“, unterwirf dich der Führerschaft und opfere dich für die höhere Sache des Kollektivs. Diese Ethik der Beherrschung und Unterwerfung, die eine neurotisch-hysterische Spannung zwischen dem Selbst und dem Kollektiv aufbaut, ist der Last der Zivilisation geschuldet und besitzt eine starke emotionelle Anziehungskraft. In Wahrheit handelt es sich um eine Ethik der Heldenverehrung. Sie kann die Freiheit des Individuums nicht dulden. Sie kann nie demokratisch sein.
Wenn schon der Einleitungssatz falsch ist…
Ich liebe Wachstum, und habe es nie rein quantitativ betrachtet. Und ich bin ein ziemlicher Globalisierungskritiker.
Die Moralisierungspolitik entspringt übrigens dem Lager der Globalisierer. Weiter kann ich leider nicht lesen, da passt einfach gar nichts.
Wachstum und Umweltschutz sind keine Widersprüche, sondern bedingen sich – sagt der Autor.
Ausgewachsener Schrott.
Die Wirklichkeit zeigt das Gegenteil.
Ich denke schon, dass beides vereinbar ist. Ein gewisser Wohlstand ist nötig, damit Menschen überhaupt an Umweltschutz denken. Ein gewisser Wohlstand ist nötig um die Technik zu entwickeln und die Investitionen aufzubringen, um Lösungen bereitzustellen.
Abgesehen davon wächst die Weltbevölkerung nun einmal, ob uns das gefällt oder nicht. Und die meisten Menschen wollen leben wie die Menschen in den reichen Ländern. Also müssen wir so oder so Lösungen finden. Und vorstellbar ist da einiges. Vertikale Landwirtschaft beispielsweise. Am Ende hängt es am Geld und an einer sicheren Energieproduktion in hinreichend großen Maßstab, womit nur die Kernenergie übrig bleibt.
Das ist mir zu binär. Technischer Fortschritt ist auch möglich, wenn nicht alles in den billigsten Produktionsstandorten unter erbärmlichsten Bedingungen hergestellt wird und man den (Gift-)müll dort einfach ins Meer kippt.
Darüber hinaus wäre es wirklich vernünftig nicht sämtliche Produktion ins Ausland zu verlegen, vor allem nicht bei essentiellen Dingen wie Energie, Medikamente und Medizinprodukte, Chemie, Maschinenbau, Elektronik, Softwareentwicklung usw. Denn sonst steht man irgendwann auf den Flugfeld und muss hoffen, dass dringend benötigte Güter geliefert werden, weil man sie sonst nicht anders bekommt. Oder dass man das Zeug nur mit Hintertürchen fremder Regierungen erhält.
Technischer Fortschritt ist auch möglich, wenn ich nicht mit den Fachkräften aus armen Ländern um eine Stelle konkurrieren muss, wo ich nur verlieren kann, da meine Lebenshaltungskosten doch ganz andere sind. Wie konkurriere ich überhaupt mit Millionen Menschen, die genauso gut, wenn nicht besser qualifiziert sind, wie ich selbst? Das akedemische Proletariat ist auch im MINT-Bereich kein Mythos. Da arbeiten Spitzenleute 70 Stunden die Woche für einen Hungerlohn, weil es einfach viel zu viel Konkurrenz um viel zu wenige Stelle gibt.
Wie stellen sich die Freunde der absolut freien Marktwirtschaft eigentlich den Aufbau eines Gesundheitssystems vor? Wie kann man ein Krankenhaus profitabel betreiben, ohne dass viele Patienten abgelehnt werden müssen? Wie verhindert man Monopole und letztlich die Oligarchie, die der Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft auch nicht unbedingt dienlich ist, da neue Produkte schlicht verboten werden?
Das Problem ist komplizierter als „mehr Staat“ vs. „mehr freie Marktwirtschaft“.
Ich finde die Beschreibung der Planwirtschaft als „Demokratisierung“ hoch gefährlich und inhaltlich falsch.Es ist ein linker Frame. (1.) Eine Demokratie beschreibt einen Entscheidungsfindungsprozess für politische Fragen. Die Mehrheit kann Gesetze beschließen. Schon insoweit ist seine Anwendung auf die Wirtschaft aber zweifelhaft, weil sie weder um einen politischen Prozess mit dem Ziel, die Rechtsordnung zu gestalten handelt und vor allem, weil hier (verfassungsrechtlich garantierte) Freiheitsrechte durch (einzelne) Bürger wahrgenommen werden. Diese Rechte sollen vor der Mehrheit und ihren Begehrlichkeiten und Zudringlichkeiten gerade schützen – dazu gibt es die Grundrechte. Mit Ihrer „Demokratisierung“ beschreiben Sie also den Prozess einer Grundrechtseinschränkung oder sogar deren Abschaffung, was die Verfassungen moderner Zivilisationen zu verhindern suchen. (2.) Zudem lässt sich in Frage stellen, ob die Planwirtschaft, also die Lenkung von oben, überhaupt mit dem Gedanken der Demokratie, der Machtausübung von unten, in Einklang zu bringen ist: Zugespitzt wären Sie auf der Autobahn der Demokraten ein Geisterfahrer, denn die Demokratie ist eine Einbahnstraße in die Gegenrichtung. Nicht der Politiker lassen die Puppen tanzen, sondern die Bürger. (3.) Und die Planung wirtschaftlicher Vorgänge ist weder den Bürgern noch den von ihnen gewählten Politikern praktisch möglich: Dafür ist die Wirtschaft zu fein gegliedert, zu kompliziert verflochten. Ich betrachte diese Frage nicht aus der Perspektive der (fehlenden) Funktionstüchtigkeit einer Planwirtschaft, sondern der Möglichkeit, „den Plan“ demokratisch zu legitimieren – also eine Anbindung an einen politischen Prozess, der durch Diskussionen und Zugang zu Informationen gestaltet wird. Selbst wenn man – unter Missachtung der Grundrechte – der Mehrheit der Bürger ein Gestaltungsrecht (über Betriebe, die einzelne Bürger aus eigenen Mitteln und mit eigener Arbeitskraft schaffen) zubilligt, ließe sich ein solcher Entscheidungsfindungsprozess praktisch nicht realisieren. Schon aus diesem Grunde gehört die Wirtschaft nicht in einen Bereich, der durch politische Entscheidungsmechanismen geprägt werden könnte. Das wäre nur ein Etikettenschwindel. (4.) Spätestens, wenn der Betrieb zudem politische Einfluss hat oder sogar beabsichtigt (der Inhaber politisch aktiv ist), zeigt sich, dass „Demokratisierung“ nur der Gleichschaltung dient. Es klingt nur netter; meint aber genau das – siehe Facebook & Co.
Herr Schäffler,
stimme vollumfänglich mit Ihnen überein. Die Globalisierung ist unter dem Strich ein Segen. Sie generiert Mehrwert und Wohlstand und erlaubt allen Völkern früher oder später, die wohlstandsstiftenden Effekte einer offenen, kapitalistischen Marktwirtschaft zu nutzen – wenn sie es denn wünschen -. Die Globalisierung hat sicher auch Nebenwirkungen negativer Art – z. B. die rasante Ausbreitung von Krankheitserregern -, dennoch überwiegen die Vorteile und Alternativen sind nicht in Sicht. Die linksgrünroten Experimente der Vergangenheit sind allesamt in Katastrophen gemündet, warum nur glauben so viele Menschen daran, dass Vorschreiben, Verbieten und Wegnehmen effizienter sind als Freiheit, Eigenverantwortung und Gewinnstreben ?
Der „Club of Rome“ hat sich in vielen Fällen schlicht geirrt. Seit den 70’er Jahren hat sich die Ernährungssituation dramatisch verbessert und die Armut global abgenommen. Den Preis dafür zahlen wir laufend und haben die Option durch technische Innovation das Leben auf dieser Welt zu verbessern. Man wird halt schlauer.
Die Globalisierung hat den Reichtum, Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Bildung weltweit möglich gemacht. Gerade Deutschland hat von der Globalisierung extrem profitiert, da wir so gut wie keine Rohstoffe haben, außer unserem Know How. Wenn wir die Globalisierung zurückdrehen, stehen wir nahezu vor dem Nichts. Es hat bereits mehrere Versuche gegeben, die Nazis und die Sozialisten in der DDR Deutschland autark zu machen und alles hier zu produzieren. Es wird nicht gelingen. Wir werden weder ausreichend Energie, Rohstoffe und Nahrungsmittel in Deutschland haben. Selbst innerhalb der EU sind wir da auf einem schmalen Grad unterwegs, weil Rohstoffe Fehlanzeige sind. Der Hauptmangel in der Krise ist die teilweise nicht transparente Lieferkette und fehlende Produktionsstandards, die zur Globalisierungskritik führen. Um Cent Beträge zu sparen, werden Lieferketten verlängert, Produktionsstandards nicht eingehalten, Just in Time produziert und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen zugelassen. Das Gesamtsystem ist auf Kante und Effizienz genäht und scheitert in dieser Krise. In Bezug auf die Versorgung mit kritischen Medikamenten ist das zwar seit Jahren bekannt, aber bisher hat kein Gesundheitsminister versucht, diese Situation zu ändern. „Und dann ist die Krise halt da“ würde Mutti sagen. Alle die heute gegen Globalisierung wettern, sollten sich mal, sofern sie in der Lage dazu sind, einen Haushalt nur mit Produkten aus Deutschland oder Europa vorstellen. Meinen Text könnte ich nicht schreiben.
Just in Time und Auslagerung von Produktion – das ist doch gerade das Markenzeichen der Globalisierung. Autarke Wirtschaft gibt es nirgends und gab es auch in der Geschichte kaum, zumindest als die großen Zivilistionen entstanden. Fehlende Produktionsstandards sind auch das Markenzeichen der Globalisierung. Denn dadurch kann kann erst der Populismus um das eAuto entstehen. Es will auch niemand diese fehlenden Produktionsstandards ändern. Wenn überall mit gleich hohem Standard produziert werden würde, würde sich die Auslagerung von Produktionsteilen in alle Welt nicht mehr rentieren. Die Globalisierung hat auch das Einkommensgefüge, was vorher noch als einigermaßen gerecht empfunden wurde, implodieren lassen. Die Führungsebenen haben sich immer größere Schlucke aus der Pulle genehmigt und im Gegenzug, wurden Unternehmensteile ausgegliedert, um die Lohnsumme zu drücken. Das ist eine ungute Entwicklung und wird ins Chaos führen und nicht zu mehr Reichtum und Fortschritt.
In einer Welt (in einem Leben), die auf Endlichkeit gründet, Unendliches bzw. Grenzenloses in Aussicht zu stellen, darf ruhig einmal überdacht sein, ohne deswegen in Kollektivismen zu verfallen. Sicher ist die Marktwirtschaft diejenige Wirtschaftsstruktur, die den meisten ein gutes Auskommen (vielleicht nicht unbedingt Reichtum) gewähren kann. Jeder Sozialismus hingegen verteilt nur die Armut und baut auf dem Ressentiment auf. Soweit so gut, nur: Die aufgeklärte Moderne hat sich selbst zur permanenten Flucht nach vorn verurteilt. Gibt es da am Ende auch ein „Paradies auf Erden“?
Bravo; hervorragend herausgearbeitet.
Als Versuch einer Antwort: Das Paradies auf Erden kann es schon definitionsgemäß nicht geben, und wurde theologisch gesehen wenn doch, dann bereits verlassen. Aber die Hölle auf Erden (vorübergehende definiert als ewige Pein ohne Hoffnung auf Erlösung) sehr wohl.
Nicht nur das Leben und diese Welt ist begrenzt; der Mensch an sich ist es in jeder Hinsicht auch.
Und werden diese seine Grenzen berührt, wird aus dem angestrebten Paradies blitzartig eine Hölle; und es ist eine unbeantwortete Frage, ob das nicht sowieso der Naturzustand dieser Welt ist, von der sich der Mensch mühsam ein wenig befreit hat, und in den er sehr schnell wieder hinein rutschen kann.
Globalisierung im klassischen Sinne bedeutet vor allem in Ländern mit einem niedrigen Lohnniveau zu produzieren und in einem Land mit höherem Preisniveau zu verkaufen. Auf diese Weise sind in der Summe einige Millionen Arbeitsplätze von Westeuropa (hohes Lohn- und Preisniveau) nach Asien und / oder Osteuropa (vor allem Kfz Baugruppen) gegangen. Das ist gut für die Länder in denen die neuen Arbeitsplätze entstehen aber natürlich schlecht für die Länder in denen diese Arbeitsplätze abgebaut werden.
Ich bin ein Gegner der Globalisierung.
Nicht aus den obigen angeführten Gründen, denn da stimme ich Herrn Schäffler durchaus zu.
Sondern aus dem Grund, das die Produktion in China/Asien nur deshalb billiger ist, weil die Produktionsauflagen in Europa entweder zu hoch, bzw. in Asien viel zu niedrig sind und weil aufgrund der Steuerlast auf die Arbeitskraft kein Produkt konkurrenzfähig sein kann.
Wer einwendet, dass in Europa die hochwertigen Produkte erzeugt werden, dem möchte ich sagen, dass das nur ein temporärer Zustand ist und sich das in den nächsten 20 Jahren massiv ändern wird.
Wenn wir die Steuerlast auf Einkommen nicht massiv senken (und damit Unternehmen die Chance geben wieder hier zu produzieren), die Wirtschaftsspionage nicht massiv bekämpfen und über Zoll nicht faire Herstellungskosten herstellen, dann wird Europa in der Bedeutungslosigkeit versinken, denn dann werden wir, wie Afrika, zu einer Außenstelle des chinesischen Imperiums.
Deutschland zahlt nach wie vor 300 Millionen Euro Entwicklungshilfe an China. Was für ein Irrsinn auf Steuerzahlers Kosten!
Heutige Globalisierung kann nur dann funktionieren, wenn die Chancen ausgeglichen sind.
Es gab »Globalisierung«auch schon früher. Man denke etwa an den Dreieckshandel (Sklaven → Rohrzucker → Waffen&Glasperlen). Und die Chancen waren niemals ausgeglichen. Heute sind wir halt die Schwachen und werden daher über den Tisch gezogen. Der Chinese freut sich, der Afrikaner lacht und bei uns hüpfen sie vor Freude. Ist doch schön. 🙂
Sehr schöner Artikel. Die Liste Irrglauben kann beliebig erweitert werden: Unsere Werte sind die Guten, Umverteilung bringt Wohlstand für alle, andere Meinung ist Verschwörung, menschengemachter Klimawandel, Coronamaßnahmen retten leben, Bill Gates kümmert sich um das Wohl von 8 Milliarden Menschen, Drosten ist Experte für Pandemien, „Wir schaffen das!“, (Stand heute) gibt keine Steuererhöhungen, Krieg ist Frieden, Niederlage ist Befreiung, Regimechange bringt Demokratie, .. keiner hat deswegen weniger, NGOs handeln im Interesse der Bürger, wir haben keine Staatsfunk, usw. usw…..
Das Wort „Globalisierung“ steht wie das Wort „BRD“ für eine Elite des Geldes und der Macht…der Unterdrückung (Bevordmung, Gesetze, Steuern und Abgaben)….denke nach…wem dient dieses Werkzeug „Globalisierung“ und „BRD“….???…uns Menschen wohl kaum…bei immer mehr Steuer und Abgabenlast…bei immer weniger Familie und immer mehr Gleichschaltung/Normung…
»immer weniger Familie« — ich kann nicht schlüssig beantworten, warum sich der Mensch fortpflanzt. Meine Mutmaßung ist, daß es keine Gründe dafür gibt, sondern nur Umstände, die ihn davon abhalten. Wenn also seit etwa 1970 die Zahl der Geburten in Deutschland den Bestand nicht ansatzweise deckt, müssen damals und seither solche Umstände eingetreten sein. Die gängige These ist die von der Empfängnisverhütung per Pille. Mich überzeugt das Argument nicht, auch wenn es seinen Einfluß haben mag. Ist es Zufall, daß auch der »Club of Rome« und der Glaube vom Ende des Wachstums aus dieser Zeit stammt?
,@schukow
Mit „immer weniger Familie“ ist immer weniger an Familie gemeint und nicht die Zunahme an Geburten
Auch hier werden ‚Globalisierungskritiker‘ angesprochen, ohne zu erwähnen, was diese eigentlich kritisieren. Unter ‚Globalisierung‘ kann seit Jahrzehnten alles und das andere verstanden werden, sozial, politisch, wirtschaftlich… also was mir gerade so passt oder eben nicht passt.
Wir müßten erst einmal lernen, nicht in einfachen Zahlen zu denken, sondern beispielsweise bei der Weltbevölkerung in Größenordnungen von 1, 10, 100, 1000 Milliarden Menschen, und zweitens von den Zahlen im Sinne von mehr = besser herunter kommen. Ist Überernährung erstrebenswert? Oder eine Überversorgung an Schmerzmitteln? Oder ist der Begriff „Über…“ grundsätzlich nicht korrekt?
Dann gilt es noch die Qualität eine Zustandes zu beachten, oder wieso bejammern jetzt so viele den Umstand, daß sich im Zuge der Globalisierung fast alle Fabriken zur Herstellung medizinischer Grundgüter an ein oder zwei fernen Orten auf der Welt sich befinden, und Lebensentscheidungen wie einst im Feudalismus von unverantwortlichen Fremden gefällt werden?
„Die Zahl der Menschen, die weltweit in absoluter Armut leben (also über weniger als 1,90 Dollar am Tag verfügen), hat sich von 44,4 Prozent im Jahr 1981 auf 9,6 Prozent in 2015 reduziert.“ Das Problem ist nur, dass die Weltbevölkerung in diesen 35 Jahren um 62%, nämlich von 4,5 Milliarden, auf 7,3 Milliarden angewachsen ist, und der Dollar wenigsten 80% seiner Kaufkraft verloren hat. Lt. Weltbank leben heute 3,4 Milliaden Menschen unter der Armutsgrenze, und verfügen über weniger als 5,50 $ pro Tag. Also gibt es keinen Fortschritt, die Armut ist größer geworden. Bis auf ein paar billige Konsumgüter aus China, die in Europa ebenso effektiv hergestellt werden können, habe ich von der Globalisierung eher nichts. Außer vielleicht die Massenansiedlung von Habenichtsen, die den Vorteil günstiger Konsumgüterpreise zunichte macht. Aber vielleicht sehe ist das auch ganz falsch, denn manchmal frage ich mich schon, was macht nur der Käse aus Süddeutschland im Kühlregal in Flendburg?
Diese 1,90$ sind natürlich kaufkraftbereinigt
Man kann es annehmen, … oder auch nicht. Jedenfalls steht es nicht da.
Herr Schäffler,
das ist endlich mal wieder etwas Balsam für die Seele im vom Geist des Sozialismus geschwängerten Deutschland. Aber wenn ich den aktuellen Wahnsinn beobachte, dann ist die Hoffnung auf Rationalität schon nur noch ein blasser Schimmer am entfernten Horizont.
Vielen Dank, Herr Schäffler. Noch ein Zusatz: Bei Globalisierung ist zu unterscheiden zwischen Bewegung von Gütern (Handel), Kapital und Menschen (Migration). Die Globalisierung seit 1945 bis heute betraf Handel und Kapitalbewegungen; Migration spielte kaum eine Rolle. Das war sehr segensreich, gerade für die Entwicklungsländer.
Heute tritt Migration in den Vordergrund. Diese Form der Globalisierung ist viel kritischer zu sehen als die beiden anderen Formen. Wer Globalisierung diskutiert, sollte klar zwischen den drei Formen Waren, Kapital, Migration unterscheiden.
„Die Präferenzen der Menschen ändern sich mit zunehmender Lebensqualität“ – das genau ist die große Lebenslüge des globalen Liberalismus. Die Chinesen und die Mohammedaner wissen es besser. Der Mensch ist kein eindimensionaler Homo Economicus, sondern sehr viel mehr.
„Der Mensch ist kein eindimensionaler Homo Economicus, sondern sehr viel mehr.“
Der Liberalismus WEISS, dass der Mensch kein Homo Oeconomicus ist. Genau DESHALB will er Freiheit: Damit der Mensch sich das, was er braucht, am Markt besorgen kann, UND damit er die Freiheit hat, Dinge zu tun, die mit dem Markt nichts zu tun haben. Der Liberalismus ist nicht marktfixiert. Wenn Menschen sich zu Gemeinschaften zusammenschließen: um so besser. Der Liberalismus ist gegen Zwangsgemeinschaften und Bevormundungen. Sie nicht?
Ich bin nur ein kleiner Anthropologe und kein postmoderner Fortschrittsgläubiger. Sie werden die Menschheitsgeschichte nicht mit ein paar progressiven Ideen verändern. Der Markt hat seit Jahrtausenden seinen Richtigkeit, selbstverständlich. Aber er ist nicht Gott. Und das ist das Problem des Liberalismus.
Nicht die Liberalen machen *den Markt* zu Gott. Politik als Religionsersatz wird von Linken, Grünen, Marxisten und rechts von den Nationalkollektivisten praktiziert. *Dort* wird Politik (oft mit zwangskollektivistischen Gesellschaftsvorstellungen) mit gottähnlichen Erlösungsphantasien beworben.
Liberale ziehen die Freiheit vor. Mit Märkten, weil sie die Menschheit aus absoluter Armut befreit haben. Gott finden muss man woanders.
Genau diese Heilsvorstellung einer Befreiung aus absoluter Armut meinte ich. Das ist genauso monokausal und mechanistisch wie sein sozialistischer Zwillingsbruder.
Nicht Sozialismus, nicht Markt… alles zu mechanisch… Vielleicht ein wenig biologisch? Oder da, wo sich Meditation und Quantenphysik treffen? Homöopathisch?
Dann kommen Sie mal raus mit Ihrem „3. Weg“ oder wie Sie ihn nennen. Nur zu. Schreiben Sie ein Buch! Etwas wie den 3. Weg gibt es nur nicht. Es ist interessant, dass die, die nicht „an den Markt glauben“ wollen, weil sie das für eine Religion halten, nun an irgendeinen 3. Weg glauben.