Viele Politiker und Journalisten – und auch manche Wissenschaftler wie etwa der französische Ökonom Thomas Piketty – sind geradezu besessen vom Thema Ungleichheit. Wie selbstverständlich wird meist vorausgesetzt: Mehr Gleichheit macht die Menschen glücklicher. Aber ist das auch so? Jonathan Kelley und M.D.R. Evans (International Survey Center Reno, Nevada) sind dieser Frage in einer groß angelegten Untersuchung nachgegangen. Die Datenbasis war ungewöhnlich umfangreich und enthielt 169 repräsentative Stichproben aus 68 Nationen, in denen insgesamt 211.578 Menschen befragt wurden.
Dabei wurde einerseits auf etablierte Fragestellungen der sogenannten Glücksforschung zurückgegriffen. Die Menschen wurden u.a. gefragt: „Alles in allem, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrem Leben?“ Die Befragten konnten auf einer Skala von 1 (unzufrieden) bis 10 (zufrieden) antworten. Zudem wurde gefragt: „Wenn Sie alles zusammen nehmen, würden Sie sagen, Sie sind: Sehr glücklich, ziemlich glücklich, nicht sehr glücklich, überhaupt nicht glücklich?“
Die Ergebnisse dieser Befragungen wurden in Beziehung gesetzt zum Grad der Einkommensungleichheit in den Ländern. Diese Ungleichheit wird mit dem sogenannten GINI-Index gemessen. Die Studie war methodisch sehr anspruchsvoll, denn Kelley und Evans hielten alle anderen Faktoren in ihren mathematischen Berechnungen konstant, die sonst Einfluss auf das Glücksempfinden haben (Alter, Familienstand, Bildung, Einkommen, Geschlecht, Bruttosozialprodukt pro Einwohner in dem betreffenden Land usw.). „Wir vergleichen zum Beispiel jemanden, der in Israel lebt, mit einer ansonsten ähnlichen Person, die das gleiche Einkommen hat, aber in Finnland lebt, wobei die beiden Nationen das gleiche Pro-Kopf-BIP haben, sich aber in der Ungleichheit stark unterscheiden (0,36 versus 0,26).“
Zudem unterschieden die Forscher auch zwischen entwickelten Ländern (vor allem in Europa und den USA) einerseits und Entwicklungsländern (vor allem in Afrika und Asien) andererseits. Nicht berücksichtigt wurden in dieser Untersuchung lediglich ehemals kommunistische Länder, da hier andere Zusammenhänge gelten (die die Forscher in einer separaten Untersuchung analysierten).
Das Ergebnis der Untersuchung war eindeutig. Dieser Zusammenhang war nicht etwa so, wie Antikapitalisten glauben, dass nämlich mehr Ungleichheit gleichbedeutend ist mit weniger Glück, sondern gerade umgekehrt: Mehr Ungleichheit bedeutet, dass die Menschen glücklicher sind: „Fasst man die Befragten aus Entwicklungsländern und aus entwickelten Ländern zusammen, ohne die wichtigen Unterschiede zwischen ihnen zu berücksichtigen, ist mehr Ungleichheit mit größerem Wohlbefinden verbunden.“
Doch auf den zweiten Blick zeigten sich deutliche Unterschiede:
In Entwicklungsländern gab es einen statistisch eindeutigen Zusammenhang von Glück und Ungleichheit – mehr Ungleichheit bedeutete größeres Glück. Die Wissenschaftler erklären das mit dem „Hoffnungsfaktor“: Menschen in sich entwickelten Ländern sehen Ungleichheit oft als Ansporn, ihre eigene Situation zu verbessern, z.B. durch bessere Bildung. Einigen Gruppen der Gesellschaft gelingt es, auf diesem Weg sozial aufzusteigen und mehr zu verdienen, und dies wiederum spornt andere Menschen an.
In entwickelten Ländern galt dieser Zusammenhang dagegen nicht. Hier führte mehr Ungleichheit aber auch nicht zu geringerem Glück, sondern die Frage, ob ein Land mehr oder weniger gleich ist, hat keine Auswirkungen auf das Glück. So gibt es kaum Unterschiede in dem Glücksempfinden zwischen Menschen in Schweden und den Niederlanden einerseits und Singapur oder Taiwan andererseits, obwohl die Gleichheit in Schweden und den Niederlanden (gemessen im GINI-Index) viel größer ist als in Taiwan und Singapur.
Zugegeben, es ist schwierig, Glück zu messen, zumal es viele kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern gibt, wie die Menschen auf die oben angeführten Fragen antworten. Aber umgekehrt ist die selbstverständliche Annahme, dass mehr Gleichheit zu mehr Glück führt, einfach eines der vielen Vorurteile der Antikapitalisten, das durch nichts belegt ist. Was Menschen unglücklich macht, ist Armut, nicht Ungleichheit. Und daher sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, wie Armut zurückgedrängt werden kann, als uns auf das Thema Ungleichheit zu fixieren.
Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe und Autor des Buches „Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung“.



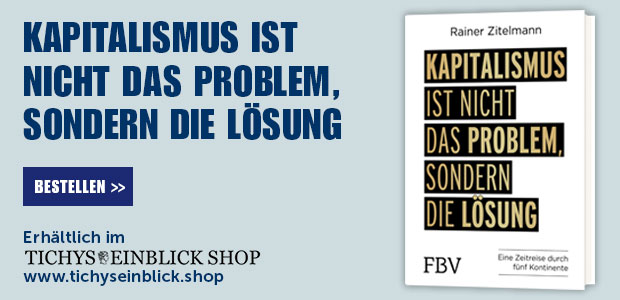
wie oft noch? Selbst die alte schwarze Bevölkerung USA landet wie ihr weißes und indianisches Pendant schlicht auf der Straße. So besonders und neu ist dieser Umstand nicht und hat mit der Hautfarbe nur bedingt zu tun. Allerdings neigen ehemals indige afrikanische/moslemische Ethnien zur Verwahrlosung in Deutschland, was aber deren Problem ist. Irgend jemand außer Merkel oder sonstige betuliche Hausfrau mag zumindest Desinteresse bekunden, weil ihre Töchter mehr und mehr an skandinavischen MÄNNERN interessiert sind. Wie gesagt, völlig uninteressant, ob irgend ein schwarzer oder Moslem über das Mittelmeer paddelt und als geborener Verlierer nicht nur dem deutschen Staat auf der Tasche liegt, sondern darüber hinaus auf Vermehrung hofft….
Absoute Gleichheit wird es nicht geben. Ist auch nicht nötig, wenn die Unterschiede sich in akzeptablen Grenzen halten. Dies ist heute nicht mehr der Fall. Wenn manche Leute zwei Jobs brauchen, um sich über Wasser zu halten, manche ein Leben lang gearbeitet haben und im Alter trotzdem arm sind, während andere 100.000 € für einen Kugelschreiber ausgeben müssen, weil sie sonst nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, dann haben wir eine Schieflage, die korrigiert werden muß.
Gleichheit erzeugt umso mehr Ungleichheit. Sieht man schön im Bildungssystem. Anstatt dass Schüler individuell nach Begabung gefördert werden, müssen halt alle auf Teufel komm raus Abitur haben und studieren.
Folge? Die Dummbatze landen an der Uni und stürzen spätestens dort ab, weil sie plötzlich merken, dass sie doch nicht so begabt sind wie ihnen eingeredet wurde. Sie werden frustriert, schreien nach Erleichterung und sind dann willige Opfer sozialistische Rattenfänger, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Die wirklich Begabten werden unterfordert, müssen die Dummbatze ertragen und bleiben auf der Strecke.
Natürlich nicht, denn es gilt: Herr, ich danke Dir, dass ich nicht bin wie der. Von „die“ ist schon gar nicht die Rede.
Die Annahme, dass mehr Gleichheit zu mehr Glück führt ist nicht selbstverständlich sondern idiotisch, denn sie basiert auf Neid. Gleichheit ist Armut, immer.
Das erste was „Antikapitalisten“ erreichen ist eine Zerstörung der Wirtschaft. Wovon dann 8 Mrd Menschen sich ernähren und ihre Konsumbedürfnisse befriedigen sollen, bleibt offen kann aber nur eine BRUTALE Senkung des Lebensstandards sein.
Spätestens wenn kein „Warm Wasser“ mehr aus der Wand kommt, dürfte für 95% der Menschen Schluss mit diesen Spinnern sein …
Bald sind es 10 Milliarden – um 2050. Mit 6 Milliarden wie dereinst im Jahre 2000 hätten wir es leichter. https://www.spiegel.de/politik/die-reichen-werden-todeszaeune-ziehen-a-628d4249-0002-0001-0000-000014344559?context=issue
Es ist doch ganz einfach: wenn Alle gleich (gemacht) sind, dann ist Alles gleich. Klingt albern? Stimmt, das tut es, ist aber richtig.
Gleichheit einzufordern für Dinge, Themen oder auch Menschen, die nicht gleich sind, ist UNSINN und hat noch nie in der Menschheitsgeschichte funktioniert.
Dazu benötigt man noch nicht einmal ein Studium.
ALLES EINE FRAGE DES MAßES,
wie so Vieles im Leben. Der Mensch steht immer im Spannungsfeld zwischen Individualität und Sozietät, soll heißen, den Anforderungen, die die Gesellschaft an ihn stellt. Ganz allein auf sich gestellt leben kann genau so wenig ein Ideal sein wie das totale Aufgehen in der gesichtslosen Masse.
Leistungsanreize sind wichtig, denn sonst ist keiner motiviert, besondere Leistungen zu bringen. Der reine Altruismus funktioniert nicht, der reine Egoismus auch nicht, aber im Zweifelsfall funktioniert ein „aufgeklärter“ Egoismus besser als Altruismus. Woran scheitert der Sozialismus immer wieder? Er geht von einem völlig unrealistischen Menschenbild aus. Von einem (hoch-) intelligenten, vollkommen altruistischen Individuum, das vielleicht in den Köpfen jener Idealisten besteht, die wie Marx oder Brecht (um nur zwei Beispiele zu nennen) aus begüterten Familien kommen, wo die Söhne nicht mehr an das eigene Fortkommen denken müssen, sondern aufgrund des Reichtums ihrer Eltern genug Müßiggang haben, um sich ideale Gesellschaften zurecht zu spinnen.
Als Jugendlicher hat mich folgende Lektüre beeindruckt: „Les Justes“ (Die Gerechten), ein Drama des Literaturnobelpreisträgers Albert Camus. Darin geht es um eine Gruppe junger Revolutionäre, die sich, selbst alle aus adligem Haus, zum Ziel setzen, die „armen Unterdrückten“ von ihren „Ausbeutern“ zu befreien. Sie töten als Terroristen dann einen Großfürst und einer der Attentäter landet im Gefängnis.
Dort trifft er auf einen Bauern, der wegen eines trivialen Deliktes sitzt. Auf dessen Frage, was er, der Privilegierte denn getan habe, antwortet er, er habe den Großfürst ermordet. Der Bauer ist schockiert, weil der Fürst sein Idol war und fragt den Revolutionär dann, warum er das getan habe. Dieser antwortet „Ich habe es für dich getan“ und fällt aus allen Wolken, als er keineswegs Zustimmung erntet, sondern mit der Wut des Bauern konfrontiert wird.
So ist es im realen Leben. Der Sozialismus ist eine Schimäre überwiegend aus privilegierten Verhältnissen stammender, abgehoben-realitätsferner Idealisten, eine wirkliche Arbeiterbewegung war er noch nie. Nicht nur Arbeiter wollen keine Gleichheit, denn sie wird den natürlichen Unterschieden der Menschen nicht gerecht.
Dies ist die eine Seite. Man kann also nicht umhin, die Marktwirtschaft als Ideal zu propagieren, das der größtmöglichen Anzahl der Menschen größtmöglichen Wohlstand gewährt.
Man kann aber auch nicht umhin, festzustellen, dass es Individuen gibt, die auf eine obszön-schamlose Weise reich sind. Ob einer wie Bezos oder die sprichwörtlichen Big Tec-Nerds, es fällt schwer sie sympathisch zu finden. Neid? Nun, vielleicht. Jedenfalls wird einem bewusst, dass man selbst jeden Cent viermal umdrehen muss, während jene gar nicht wissen, wohin mit ihrem vielen Geld. Hinzu kommt, dass Superreiche nicht selten höchst fragwürdige Projekte finanzieren (z.B. illegale Einwanderung) oder linke Gesinnung unterstützen, um sich mit einem humanitären Feigenblatt zu kleiden. Da ist eine unglaubliche Verlogenheit mit im Spiel: man kann nicht gleichzeitig „young global leader“ und „ökologisch“ sein. Das sind Dinge, die sich gegenseitig ausschließen.
So gesehen ist es gar nicht so verwunderlich, dass gerade die Geldelite oft den Sozialismus finanziert (siehe USA, paradoxerweise war der rechtskonservative Trump für die Arbeiter, während der linke Biden eine Marionette des Großkapitals zu sein scheint. Unappetitlich.
Aber so unappetitlich es auch sein mag, bolschewistische Gleichheit kann keine Alternative sein. Und sie ist letzten Endes nur die Kehrseite einer Medaille, auf deren Vorderseite sich der neureiche Geldadel à la Big Tec (der trotz gegenteiliger Bekundungen weder „sozial“ noch „ökologisch“ sein kann) tummelt.
Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ja, es ist wohl das Festhalten an gewachsenen Strukturen, an dem, was man Heimat nennt, das Ermöglichen von Selbstverwirklichung abseits von schamlos-obszöner, frevelhafter Raffgier, das Sich-Stemmen gegen gewissenlose Globalisierungsprofiteure, das Finden des gesunden Maßes.
Gleichheit gibt es nicht. Diese Forderung bzw dies Konzept ist auf der irrigen Prämisse aufgebaut, dass Gleichheit möglich sei.
Systematisch analysiert in allen Bereichen (- von Mann/Frau über Arbeitsbereich einschl.Militär bis zum Sport) hat das der israelische Autor Martin van Creveld in dem Buch „Gleichheit – Das falsche Versprechen“.
Wer Gleichheit fordert, lügt.
Fragen sie die „besonders“ Gleichen unter den Gleichen. Die sind glücklicher!
(Alte Kommunistenweisheit)
Die sozialpsychologische und individualpsychologische Sicht auf das Thema hat sicher seinen Wert. Politisch ist aber eine starke Ungleichheit sehr wohl problematisch. Einmal ist wichtig ob die Ungleichheit und ihre Ursachen transparent sind. Die Ungleichheit entsteht in wirtschaftlichen Prozessen, die in Rechtsordnung und Politik eingebunden sind. Je ungleicher die ökonomischen Bedingungen in einer komplexen Gesellschaft, desto mehr werden die Reichen mit gesetzlichen Privilegien zu „rent-seekern“ und es verfestigen sich “ Klassen“ die nicht oder nur wenig durchlässig sind. Das hat, in extremis, Karl Marx im frühkapitalistischen England zu seiner Thesen geführt. Im Raum Chicago hat eine Universität eine kleine Studie zwischen zwei Wahlkreisen, einer nördlich und einer südlich der Innenstadt, gemacht. Neben vielen Zahlen ist mir am erschreckendsten aufgefallen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung über viele Jahre mehr als 25 Jahre unterschiedlich war, ca. Anfang 60 im armen Wahlkreis, und über 85 im wohlhabenden. Die auf der besseren Seite der Ungleichheit sind mit Sicherheit, sozialpsychologisch zufriedener. Große Ungleichheit produziert aus sehr komplexen Gründen soziale Spannungen, die in allen komplexen Gesellschaft immer wieder zu mehr oder weniger gewalttätigen, sozialen Eruptionen und Exzessen führen. Südafrika und Brasilien scheinen auch gute Beispiele dafür zu sein. Es lohnt sich Ungleichheitsanalysen auch über mehrere Jahrzehnte, für Deutschland ab 1949, anzusehen.
Unabhängig vom „Glück“, denke ich, dass Staaten am stablisten sind, wenn es möglichst viele Menschen der „Mittelschicht“ gibt: Leute, die Eigentum haben. Z.B. Bauern mit eigenem Hof, Handwerker mit eigenem Betrieb. Sonstige Selbstständige und Freiberufler. Aber auch Angestellte mit eigenem Haus.
Arme Menschen ohne Eigentum und reiche Menschen, die auch ohne Staat auskommen, sind keine „Stütze“ für den Staat.
Und im Grunde ist es das Ziel jeden Staates (wenn er nicht gerade wahnsinnig ist), dass er selbst erhalten bleibt.
Gleichheit macht nicht glücklich. Verbundenheit macht glücklich , ganz gleich ob zwischen Gleichen oder Ungleichen.