Drei Jahre nach seiner großen, mit „Ein deutsches Leben“ untertitelten Martin Heidegger-Biographie, die vielleicht die beste überhaupt ist, hat Lorenz Jäger ein neues Buch vorgelegt. Das Thema ist nicht ganz unheideggerianisch, geht es doch in „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ um eine Konfrontation mit dem Tod und damit einhergehend um die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit der menschlichen Existenz. Dennoch handelt es sich nicht um ein weiteres Heidegger-Buch aus Jägers Feder. Der Meßkircher Meisterdenker kommt zwar vor, ist auf den gut 260 Seiten aber nur ein Referenzautor unter vielen.
Wie Jäger im Prolog erklärt, der den insgesamt 19 nicht zu langen Kapiteln vorgeschaltet ist, war der Anlass für dieses Buch das „Erschrecken über die Expertokratien“ – der Rezensent denkt unweigerlich an das Gesundheits-, Lebens- und Sterbensregime der Covid-Zeit. Auch die Intention des Buches wird vom Autor deutlich herausgestellt: Das Buch plädiere „für eine Wieder-Aneignung, Neu-Aneignung der enteigneten Künste des Lebens und Sterbens“. Die Hauptquellen für eine solche Rehabilitierung der Kunst, das eigene Leben in Auseinandersetzung mit dem unausweichlichen eigenen Tod zu gestalten, sind für Jäger einmal die griechische Antike sowie die Welt des Alten Testaments. Eine kluge Entscheidung, kommt doch der Zustand der eigenen Gegenwart – samt ihren Pathologien – erst in den Blick, wenn man ausreichend geistige Distanz zum Zeitgeist gewonnen hat.
Von Platon bis Walter Benjamin
Der Leser darf allerdings keinen stringent durchargumentierten philosophischen Traktat zu Leben und Tod erwarten. Erst recht nicht – und glücklicherweise – handelt es sich um ein Stück abgeschmackte Ratgeberliteratur, die mit den besten Tipps für ein gutes Leben und Sterben aufwartet. Stattdessen tritt Jäger, der das Ressort Geisteswissenschaften der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über Jahre geprägt hat, in diesem Buch als großer Feuilletonist auf. In lebendig-eleganter Sprache, die niemals etwas Gespreiztes hat, lässt Jäger den Leser an seinem reichen Bildungsschatz, der weit über den Durchschnittskanon hinausgeht, teilhaben. Dabei gelingt Jäger das Kunststück, den gleichermaßen verbreiteten wie peinlichen Erklärbärton zu vermeiden, ohne in das andere Extrem einer abgehobenen Bildungshuberei zu verfallen. Ob es um die Parallelen und Differenzen zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und dem Gilgamesch-Epos oder um die Vergänglichkeitsästhetik des „mittelalterlichen“ japanischen Romans „Genji Monogatari“ geht – mit fast jeder Zeile Jägers erfährt der Leser etwas Bedenkenswertes, ohne das Gefühl zu haben, belehrt zu werden.
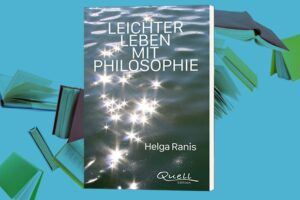
Leben mit dem Abgrund: Wie uns Philosophie helfen kann
Ein Buch, das man langsam lesen muss
Dennoch sei es dem Rezensenten nicht als Zeichen jener Borniertheit, die die eigene Leseerfahrung zum allgemeinen Kanon erhebt, angerechnet, wenn er bedauert, dass Albert Camus im gesamten Buch, einschließlich des Kapitels über den Selbstmord, keine Erwähnung findet. Der Literat und Philosoph Camus meinte schließlich, im Selbstmord das philosophische Problem schlechthin identifiziert zu haben. „Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord“, heißt es zu Beginn seines Buchs „Der Mythos des Sisyphos“. Und weiter: „Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten. Alles andere – ob die Welt drei Dimensionen und der Geist neun oder zwölf Kategorien hat – kommt später.“
Aus der Fülle des von Jäger bearbeiteten Materials ergibt sich noch eine weitere Schwierigkeit: Liest man zu schnell, kann die Tatsache, dass sich der Autor meist schon nach wenigen Absätzen einem neuen Werk zuwendet, um es für den Leser zusammenzufassen, etwas Ermüdendes haben. Entschleunigtes, bedacht-reflektierendes Lesen der kurzen Passagen ist also gefragt. Erst dann entfaltet das Buch seine volle, den Geist stimulierende Wirkung. Am stärksten ist „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ jedoch immer dann, wenn Jäger sich deutlich mit eigener Stimme, eigenen Gedanken zu Wort meldet. So etwa im Kapitel „Das Leben nehmen“, in dem sich der Autor mit dem Mord auseinandersetzt. „Warum mordet der Mensch?“, fragt Jäger und gibt sich nicht mit den üblichen Hinweisen auf Geldgier, Eifersucht oder pervertierte sexuelle Leidenschaft zufrieden. Dagegen lautet seine Hypothese: „Mir scheint, es gebe Taten, die nur daraus zu erklären sind, dass dem Opfer eine gewisse Leuchtkraft eigen war, die aus dem Sein kam, aus der Existenz, und die mit allem Geld der Welt (zur Befriedigung der Habgier) nicht auszugleichen war.“
Ohne Nihilismus oder Gefühlsduselei
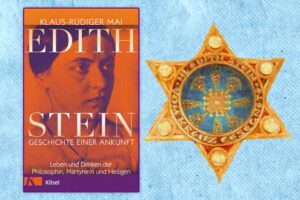
Edith Stein – Sache der Freiheit ist es, dem Gewissen zu folgen
Der Ton des Buches ist trotz des Themas nie makaber, nihilistisch oder gefühlsduselig. Das würde auch gar nicht zum eigentlichen Anliegen des Verfassers passen, das darin besteht, nach Vorbildern und Anknüpfungspunkten für eine gelungene „Ars Moriendi“ zu suchen, wie sie Jäger etwa in dem bereits erwähnten posthumen Werk Kronauers verwirklicht sieht. Besonders die Geschichte „Grünewald“ hat es ihm angetan. Hier findet Jäger, worauf es bei der Kunst des Sterbens ankomme: „Bewusst und wach angesichts des Kommenden, ohne Illusionen und Bitterkeit, die Gedanken auf das einzig noch Wesentliche gerichtet. Das ist mehr als der eigene Tod – es ist der bewusst angeeignete, den man sich zum eigenen gemacht hat.“
Wenn es einen Aspekt des Sterbens gibt, der bei Jägers tiefsinnigem Umkreisen des Phänomens etwas unterbelichtet bleibt, dann vielleicht die Tatsache, dass der Tod ein grässlicher Stachel im Fleische des Menschen ist. Philosophisch gesprochen, droht mit dem Tod die Sinn-Kette der menschlichen Handlungen für immer abzureißen und damit das Tun und Streben des Menschen im Ganzen sinnlos zu werden. Theologisch gefasst ist der Tod ursprünglich auch nicht Teil des Planes, den Gott für den Menschen vorgesehen hat – vor dem Sündenfall gab es für Adam und Eva kein Sterben. Daher ist und bleibt der Tod ein absolutes Skandalon. Überwunden ist er allein für den Christenmenschen durch die Erlösungstat seines Heilands, der ganz Gott und ganz Mensch zugleich ist. So gesehen ist es überaus treffend, dass Jäger sein unbedingt lesenswertes Buch mit den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz enden lässt, die er als Leitfaden „für Sterbende und für jene, die sie dabei begleiten, am Ende für alle Sterblichen“ deutet.
Lorenz Jäger, Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens. Rowohlt Berlin, 272 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 25,00 €.
Dieser Beitrag von Sebastian Ostritsch erschien zuerst in Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zur Übernahme.

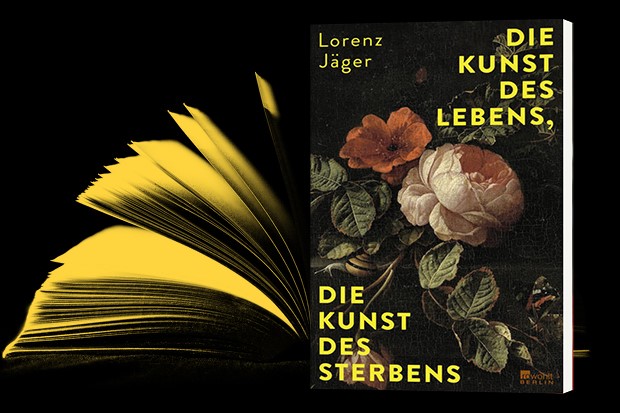

Wir sind für ewiges Leben geboren — das glaube ich und ist mir Gewißheit und macht mich froh. Aber mir ist auch bewußt, daß Jesus sagte, daß, wer nicht glaubt und die Gebote Gottes nicht befolgt, zum Tod verurteilt wird. Gottferne bedeutet Tod. Jeder Mensch möchte doch ewig leben.
War es jener Lorenz Jäger, der ca. 2005 in Deutschland die Entstehung eines „jakobinischen Tugendstaats“ befürchtete, später aber zum großen Merkelbewunderer wurde? . . .
Gaius Julius Caesar: „Der Tod, ist mehr ein Tag der Freude als der Trauer“
Soweit muß man ja nicht gleich gehen, weil er sicherlich an diesem Tag keine Zeit mehr hatte darüber zu sinnieren und es sicherlich vorher festgestellt wurde, was aber keinesfalls seine Feststellung schmälert, wenn man noch etwas denken kann.
Allein die mageren Kommentare zu diesem Thema belegen doch, wie es um uns bestellt ist, wo man mitten im Leben steht um es auch voll auskosten zu können, mit allen Vor- und Nachteilen die darin stecken und eigentlich belegen, daß man sich vor dem nahenden Ende fürchtet, anstatt ihm rechtzeitig ins Antlitz zu sehen, was besser ist, sollte es überraschend erscheinen.
Das Leben als solches ist in seiner Bestimmung uns völlig unbekannt und bleibt von Anfang bis Ende ein einziges Mysterium und der einzige Halt der geboten wird ist an ein übergeordnete Kraft zu glauben, um dem gesamten Wahnsinn stand zu halten, der uns von morgens bis abends umgibt, mit allen Facetten die sich darin vereinen, bei der Nächstenliebe angefangen, bis hin zum Gegenteil was bereits in diesem Stadium das Leben zur Hölle machen kann.
Im Gegensatz zu früheren Hochkulturen ist demzufolge der göttliche Einfluß immer mehr geschwunden und man hat es in der Zeit der sogenannten Aufklärung für sich selbst reklamiert, als letzter Trugschluß und Anmaßung vor dem Untergang, denn wir sind ein kleiner atomarer Teil des Universums und das schert sich keineswegs um seine kleinsten Lichter und darunter soll es ja auch noch welche geben, die trotz ihrem erworbenen Wissen immer noch an die göttliche Allmacht glauben und nur der Narr, der zwangsläufig auch Heidegger nicht verstehen wird, treibt es bunt und deshalb hat auch die Kirche in weiser Voraussicht, das Narrentreiben gestattet, als Ventil menschlicher Unfähigkeit, etwas mit dem Geist zu erfassen, was den meisten verschlossen bleibt, weil er vielen fehlt.
Das heutige bunte Narrentreiben der zweiten Generation zum Zwecke der eigenen wirren Bestätigung ist ebenfalls einer der Auswüchse, die schon des öfteren in der menschlichen Geschichte vorgekommen sind und das fand in Sodom und Gomorra bereits statt und der Tanz um das goldene Kalb, einschließlich des sündigen Babylons war auch eines der menschlichen Verirrungen und damit geht es weiter bis uns der Tod vom Leben trennt und damit endet alles was wir in einer minimalen Zeitspanne erleben durften, während uns das Nirwan umfaßt und nie mehr los läßt, egal ob wissend oder unwissend, was uns zusammen mit unserem körperlichen Gehäuse ehedem nur geliehen ist.