Haben Sie sich schon eine Popcornmaschine angeschafft? Es könnte sich lohnen, denn die Enthüllungen um das „Rechercheportal“ Correctiv versprechen noch zahlreiche Stunden ereignisreichen Kinos. Vielleicht war es keine gute Idee, durch manipulative Berichterstattung eine nationale Massenpsychose auszulösen, und damit unweigerlich Aufmerksamkeit auf die eigenen Methoden und das journalistische Selbstverständnis zu lenken?
Sarkasmus beiseite: Wie die Berliner Zeitung nun berichtet, und durch eine Anfrage des AfD-Politikers Leif-Erik Holm bestätigt, traf sich der Geschäftsführer von Correctiv mehrfach sowohl mit Vertretern der gegenwärtigen als auch der ehemaligen Bundesregierung. Zum nichtöffentlichen „Gedankenaustausch“, unter anderem, um über „Desinformation“ zu sprechen. Ein Verhalten, welches das ohnehin angekratzte Vertrauen in die Medien als „Vierte Gewalt“ nachhaltig beschädigt. Die Bevölkerung erwartet von Journalisten zu Recht Unbestechlichkeit und Unabhängigkeit, bzw. dort, wo Letztere nur teilweise gegeben sein kann, zumindest Transparenz.
Nur acht Tage vor dem Treffen in Potsdam soll sich Correctiv-Geschäftsführerin Jeanette Gusko mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen haben. Sie habe laut Bundesregierung „spontan“ am 17. November 2023 stattgefunden. Am 7. November 2023 fand eine Diskussionsrunde im Bundeskanzleramt statt, bei der Gusko ebenfalls teilnahm. In den letzten vier Jahren haben sich Regierungsvertreter und Correctiv demnach elfmal getroffen. Das berichtet NIUS.
Der Verdacht der Hofberichterstattung schmälert nicht nur die Glaubwürdigkeit von Correctiv und der deutschen Medien insgesamt, der Gesprächsschwerpunkt „Desinformation“ weist auf eine tiefgreifendere Problematik hin: Wie gehen wir mit einer Informationsgesellschaft um, in der jeder mit einem Social-Media-Konto „Medienschaffender“ ist?
Tatsächlich ist es eine drängende Frage, wie die Qualität von Informationen gesichert werden kann. Der Kontrollreflex, den regierende Politiker hier entwickeln mögen, ist verständlich. Ihm nachzugeben, ist indes kurzsichtig und kontraproduktiv. Denn aus dem Ansinnen, Information zu filtern, wird postwendend jenes, den Informationsfluss auf intransparente Weise zu steuern. Selbst wenn derartige Mauscheleien nicht immer ans Licht kommen: Werden sie bekannt, ist der Schaden immens, wenden sich immer mehr Bürger von etablierten Medien ab und suchen Alternativen.
Zudem leidet unsere Gesellschaft unter zunehmender Polarisierung. Unterschiedliche Ansichten bewegen sich oft nicht mehr auf der Basis derselben Realität, sondern auf dem Boden unterschiedlicher Wirklichkeiten, die zum Teil auf einander entgegengesetzten „Faktenlagen“ beruhen. Ein Umstand, der sich im neudeutschen Wort „Bubble“ ausdrückt, der aber viel gravierender ist, als der Begriff vermuten lässt – eine Seifenblase kann man zum Zerplatzen bringen; wir haben es jedoch mittlerweile mit Betonwänden zu tun, die die Wahrnehmungswelten der Bürger voneinander trennen. Dem kann nur eine möglichst breite Darlegung der Fakten entgegenwirken – was freilich einer pointierten Einordnung im Nachgang keineswegs widerspricht.
Es ist vielsagend, dass die Protagonisten, die sich selbst als „Faktenfinder“, „Faktenchecker“ und eben als „Correctiv“ betrachten, geradezu das Gegenteil befördern: Erwünschte Ansichten, die Gegenstand von Kontroverse sind, werden als „Fakten“ dargestellt, und damit der Diskussion enthoben. Missliebige hingegen werden als „Fakenews“ definiert. Der Deutungsrahmen wird festgeschrieben – nicht durch Argumente, sondern durch den moralischen Appell, wie etwa die manipulierten NS-Parallelen der Potsdamer Correctiv-Veröffentlichung zeigen.
Angesichts der mittlerweile sieben eidesstattlichen Erklärungen, die dem Kern der vermeintlichen „Recherche“ – den angeblich geplanten massenhaften Ausweisungen – widersprechen, lässt sich die Frage stellen, inwieweit Fakten auch schlicht „erfunden“ werden. Desinformation als legitim zu betrachten, sobald sie der eigenen Haltung entspricht, und andererseits das, was bestimmten Akteuren missfällt, als Desinformation zu kennzeichnen, ist ein ganz besonders besorgniserregender Trend: Wir steuern auf eine postfaktische, rein weltanschaulich bestimmte Medienlandschaft zu, wenn wir derartige Entgleisungen tolerieren. Eine selbstkritische Kurskorrektur ist dringend vonnöten.


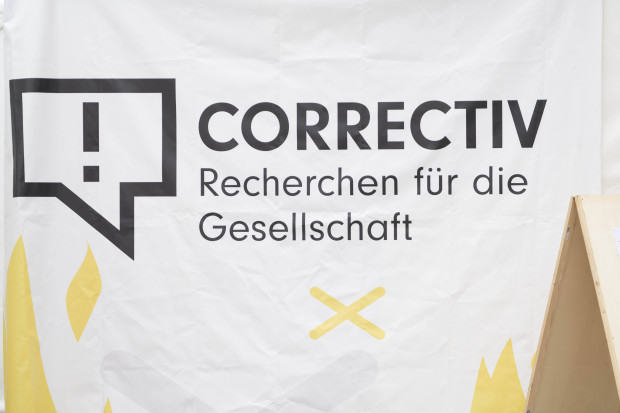


Kleine Korrektur: Wir steuern nicht drauf zu, wir sind mittendrin. Vielleicht hat es sich zugespitzt, vielleicht wird es aufgrund der abnehmenden“Qualität“ und zunehmender Quantität einfach immer nur offensichtlicher, aber „postfaktischer Kampagnenjournalismus“ ist nichts Neues.
Ich kann mich an keinen politikmedialen unterstützten/geforderten Krieg der letzten Jahrzehnte erinnern bei dem früher oder später nicht auch „andere Fakten“ an`s Tageslicht kamen. Selbiges gilt für unzählige Attentate und Anschläge.
Ich fürchte, der Trend ist wenig bis gar nicht aufzuhalten – wie wir in den USA bereits seit Jahren sehen können.
Waren Sender oder Zeitungen wie Fox oder Bild lange eher konservativ oder gar „populistisch“, sind sie jüngst den „rotgrünen“, progressiven Zeitgeist sehr viel näher gerückt, zahllose andere „Outlets“ (Sender wie Print) sind schon seit Jahren „all in“ im woken, sehr rotgrün-lastigen, angeblich progressiven „Zeitgeist“ mit seiner Standard-Agenda, Haltung etc.
Das mag zum Teil daran liegen, dass viele die beruflich zu Medien kommen schulisch und insbesondere universitär „linkslastig“ sozialisiert wurden oder an üppigen Spenden von schwerreichen Gönnern aus den USA, die sich auch mal gerne ganze Zeitungen und Sender kaufen – wer weiß. Nicht wenige vermuten bösartige Allianzen zwischen Berufspolitikern, Superreichen, gekauften NGOs und gekaufter „Zivilgesellschaft“ und vieles spricht dafür, daß das keine VT für Aluhüte ist.
Jedes Treffen des WEF in Davos untermauert den Verdacht oligarchischer, neofeudaler Bestrebungen und Trends im ganzen „Westen“ umso mehr. Die investigative Journalistin/Bloggerin Witney Webb schreibt und veröffentlicht insbesondere dazu seit Jahren, sie lebt mit ihrer Familie mittlerweile fern den USA in Chile.
Und vor wenig bis nichts haben diese neuen westlichen „Oligarchen“ oder „Feudalherren“ mehr Angst, als vor echter Demokratie. Sie wissen natürlich, dass sie nebst ihrer Privilegien in der krassen Minderheit sind und für sie „wenig hilfreiche“ (aka populistische, radikaldemokratische, wirklich „linke“ etc) Regierungen auf so blöde Ideen wie deutlich höhere Besteuerung oder gar Zerschlagung ihrer Imperien und Firmenkonglomerate kommen könnten.
Solange Dummköpfe nur von „Tax the rich“ reden oder sich auf ihre Cocktailkleider drucken lassen, aber alles bleibt wie es ist, ist alles ok. Wenn aber solche wie Trump oder andere Quer/Neueinsteiger wirklich was ändern wollen, noch nicht gekauft werden könnten oder selbst schon genug besitzen, herrscht ganz oben Unsicherheit – dann sind ihre Privilegien aka „die Demokratie“ in Gefahr.
Und selbst in der deutschen, politischen Provinz handeln Faeser, Habeck, Merz und Co nach dem gleichen Strickmuster: sind deren Privilegien und deren monopolartige Deutungshoheit in demokratischer Gefahr, behaupten sie einfach, die Demokratie sei in Gefahr und um sie zu schützen, schaffen sie sie ab oder schränken sie immer weiter ein. Der offizielle, staatliche „Kampf gegen Rechts“ läßt sich auch leicht so lesen – ein altes Machtkartell sieht seine Macht erodieren und will schlicht nicht mit neuen Wettbewerbern teilen oder gar ganz in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Menschlich sogar verständlich und nachvollziehbar, nur leider krass antidemokratisch und verfassungswidrig.
Auch im Sport hat kein Meister (von gestern) Anspruch auf ewige Tabellenführung, heute, morgen und für immer, erst recht nicht, wenn er faul und träge wird, sich auf alten Lorbeeren ausruht.
Nur in der Politik sind anscheinend viele der Meinung, daß Wettbewerb aka Demokratie zwar gut und schön sei, nur man selbst nie dabei arbeitslos werden, seine mühsam errungenen Privilegien niemals verlieren dürfe, ja sogar Faulheit und wirre Ideen gegen alle Interessen der eigenen Wähler völlig ok seien und niemals zur Abwahl berechtigen würden – die eigenen Ideen sind ja bekanntlich immer die besten auf der Welt, erst recht wenn man selbsternannter „Gutmensch“ ist, also links denkt und redet und gleichzeitige sich und Milliardäre reich und reicher macht.
Kurzum: Wettbewerb ist doof, außer man hat selbst ewige Gewinngarantie – so einfach, LOL…
Ein m. E. sehr treffender Text. „Vielleicht war es keine gute Idee, durch manipulative Berichterstattung eine nationale Massenpsychose auszulösen, und damit unweigerlich Aufmerksamkeit auf die eigenen Methoden und das journalistische Selbstverständnis zu lenken?“ Doch, war es.
Die in den Demos zum Ausdruck kommende Massen-Solidarisierung von Hunderttausenden Menschen konnte ja nur zustande kommen, weil die Realitätswahrnehmung eines kleineren Teils der Bevölkerung inzwischen von Emotionen und purer Moral geprägt, d.h. dominiert ist, anstelle von Logik und Vernunft.
Nur deshalb werden rechts und rechtspopulistisch und Neue Rechte und rechtsextrem und AfD unterschiedslos über einen Kamm geschert und kann man im Kampf gegen Rechts all die großen gesellschaftlichen und ökonomischen Probleme im Bauch galant beiseiteschieben. Man fragt sich, ob angesichts mangelnder logischer Differenzierung (ich nenne das mal so) unser Bildungssystem, ggf. auch die Journalistenausbildung, nicht ganz funktioniert hat oder die zunehmende Verbreitung und finanzielle wie politische Stärkung von weltanschaulich vereinnahmten staatlichen Stellen, Vereinen und sogenannten NGOs das öffentliche Narrativ so stark beeinflusst hat. Mit hoch emotionalisierten Schlüsselwörtern, die reflexartige weitgehend unüberlegte Empörung und moralisches Beben entfachen (siehe „Remigration“ und „Vertreibung von Millionen von Menschen“).
Mir fehlt leider die Fantasie, mir vorzustellen, dass und wie man die Spaltung der Gesellschaft und tendenziell „postfaktische, rein weltanschaulich bestimmte Medienlandschaft“ wieder einfangen kann.
Die Anfrage des Abgeordneten Leif-Erik Holm lautete, ob ein Treffen mit Correctiv im Ministerium stattgefunden hat. Nicht, ob es spontan war. Das Ministerium antwortete korrekt mit den Datum des Treffens und zusätzlich ungefragt, das dies spontan stattgefunden hätte. Das Kommunikations-Genie im Ministerium, welches völlig unnötig dies dahergeplappert hat, kann man jetzt schön in die Zange nehmen: „Na, Freundchen, niemand hat bisher gemutmaßt, daß die Treffen mit Correktiv im Ministerium planmäßig stattfinden könnten. Warum ist es Ihnen ein Bedürfnis, diese vorauseilend als spontan zu bezeichnen? Stimmt da was nicht?“
Die Antwort steht übrigens in 1984 von George Orwell. Wenn das Ministerium sagt, die Treffen haben spontan statt gefunden, haben sie NICHT spontan stattgefunden.
Die sind mir schon um die 2015 herum aufgefallen und immer wenn der investigative Journalismus an die große Glocke gehängt wird, kann man sich einigermaßen sicher sein, daß es Linksableger sind und nur dazu dienen sollen, die alten abgewetzten roten Revolverblätter zu entlasten und deshal hat man sich völlig unverdächtig 2013 daran gemacht eine neues zentrales Kampfblatt zu entwickeln.
Verdächtig machten sie sich schon deshalb, weil sie aus dem Nichts heraus einen personellen Aufwand betrieben haben, der in keiner Relation zum umkämpften Markt steht und nach entsprechenden Recherchen war klar, wer dahinter steckt, nämlich traute Gemeinsamkeit zwischen Regierung und den Mainstream-Medien um sich auf neue Art zu präsentieren, weil Relotius das Image doch sehr angeschlagen hat, was man damit korrigieren wollte und darüber hinaus sich auch neu formiert hat.
Die einzigen die es nicht bemerken wollten waren wie immer die deutschen Leser und so konnten sie im dunkeln munkeln und haben dann nach linker Art des Hauses zum Schluß nach alter Art den Vogel abgeschossen, indem sie mangels Masse etwas in Potsdam erfunden haben, was ihnen nun nachhängt und nicht gerade vertrauensfördernd ist.
Das bekommt man auch bestätigt, daß die türkische Regierung einen dortigen Ableger offiziell gesperrt hat, denn die sind doch etwas schlauer, wenn es um die Verteidigung ihrer politischen Interessen geht, während bei uns die Roten und Grünen mit ihren medialen Helfershelfern residieren, als gehörte das Land ihnen ganz allein und mit dem Fehler der Redaktion haben sie sich einen Bärendienst erwiesen, denn nun sind sie im negativen Sinne bekannt wie der Stern und der Spiegel und das wird ihnen noch lange nachhängen, zumindest bei jenen, die sich ungern verschauckeln lassen.
Im übrigen ist die Vereinnahmung der Medienlandschaft von Amts wegen eine Spezialität aller Sozialisten, denn damit können sie bis zu einem gewissen Grad ihre „Glanzleistungen“ übertünchen oder fordern, was aber immer schwieriger wird, denn wer befaßt sich noch mit diesem Schund, wenn er Alternativen hat und sie nur benützt um strategisch auf dem Laufenden zu sein.
Die mediale Verfälschung durch linke Kreise hat man jüngst beim Besuch in Washington gesehen, wo einer zum Rapport antreten mußte um als Lückenbüßer seine Befehle entgegen zu nehmen und mit dieser weiteren finanziellen Last beladen verkündet er nun voller Freude ein gelungenes Gespräch, wobei er recht hat, wenn man es aus Sicht der Amis betrachtet und noch erbärmlicher kann man nun wahrlich nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten, als letzter Beweis, daß wir als Wähler alles falsch gemacht haben, wie es schlimmer nicht geht.
Im täglichen Leben läuft es nun so ab, die USA produzieren Munition für die Ukraine im Wert von 7 Milliarden Dollar und die Deutschen gehen in finanzielle Vorleistung, weil sie über das Repräsentantenhaus Ladehemmung haben und wir dürfen dafür einspringen und niemand fragt den deutschen Steuerzahler ob er dazu bereit ist und so handeln Friedensfreunde und rote Schein-Patrioten, die man am liebsten von hinten sieht, damit man den Spuk nicht weiter betrachten muß.
Na immerhin hat sich Correctiv mit seiner Posse ja als das geoutet, was sie sind: nämlich keine Organisation zur Bekämpfung von Desinformation, sondern zur BETREIBUNG von Desinformation.
Zumindest in Bezug auf die selbsrgebaute Echokammer zwischen Politik und Quantitätsmedien gebe ich Ihnen Recht.
Der Hinweis auf die Extremistrnerlasse ist interessant.
Ich glaube aber, dass in den großen Medien in einer Zeit der wegfallenden Geschäftsgrundlage durch die Digitalisierung (inkl. direktem Zugang der Bürger zu Informationen und Wegfall von Anzeigenfinanzierung), die Beschäftigungsverhältnisse so prekär geworden sind, dass sich dafür vorwiegend verzichtsbereite Menschen mit Sendungsbewusstsein finden, angezogen von der Möglichkeit, ohne Wahl politisch Einfluss nehmen können. Und diese Menschen sind nun meist im linken Spektrum angesiedelt.
Gleichermaßen gibt es trotz Extremistenerlassen keinerlei Mangel an linken Lehrern.
„Nur acht Tage vor dem Treffen in Potsdam soll sich Correctiv-Geschäftsführerin Jeanette Gusko mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen haben.“
Es gab also tatsächlich ein Geheimtreffen. Allerdings ohne Kameras und Richtmikrofone. Peinlich für den Olaf und die ganze linksgrüne Blase, dass das jetzt publik wird. Der ÖRR wird aber sicher nichts davon berichten, darauf können sich Scholz, Faeser & Co. verlassen. Und der Olaf hat den Gesprächsinhalt bestimmt längst vergessen. War da was?
Jeden Tag erfährt man Unfassbares darüber, was in diesem einst funktionierenden Land abgeht. Aber wer die einzige Oppositionspartei wählt, ist natürlich Nazi.
Sie knicken alle ein und kriechen auf dem vorgegebenen Meinungskorridor entlang. – Gemeint sind Journalisten, die nicht mehr selber denken wollen, sondern stets nach dem Sagbaren schielen und die blanken Tatsachen verdrängen (denken zu müssen).
In diesem Land wird mittlerweile mehr gelogen , vertuscht und verdreht als es sich die SED und ihre Medien je erlaubt haben! Wann endlich merken das die Menschen dieses Landes?
Und Ich halte die Aussage, dass regierungsnahe sog. Faktenchecker regierungsfreundliche Ergebnisse bringen, nicht nur für sehr wahrscheinlich, sondern als 100 prozentig erwiesen und jeder der des Selbernachdenkens mächtig ist weiß das inzwischen.
Da ich mittlerweile sämtliche Deutschen große Medien meide und nur noch Ausländische Medien konsumiere, und natürlich TE , merkt man sehr schnell was für eine verlogene und unfähige Medienwelt in Deutschland haben, die nur noch Meinungsmache ist ! Es ist auch eine Wohltat , über den Ukrainekrieg, den Krieg in Israel , die globale Wirtschaft , Putin und das Interview mit Carlson usw … vernünftige und neutral verfasste und gut recherchierte Artikel zu lesen , das findet man in Deutschlands Leitmedien nicht mehr !
„Wir steuern auf eine postfaktische, rein weltanschaulich bestimmte Medienlandschaft zu, wenn wir derartige Entgleisungen tolerieren. Eine selbstkritische Kurskorrektur ist dringend vonnöten.“
100% Zustimmung, die Gefahr ist schon sehr real.
Es wird mehr und mehr zu einem Fulltimejob, das Dickicht aus Information und Gegeninformation zu durchblicken.
In dem allgemeinen Informationschaos setzt sich der lauteste durch.
So dumm die einzelne Desinformationskampagne sein mag (Wannsee 2.0) –
während man sich noch daran abarbeitet, die eine Lüge aufzudecken und aufzuarbeiten, rollt schon die nächste Welle durch die Öffentlichkeit.
So wird die Wahrheit marginalisiert, es gilt letztendlich das Recht des Reichweitenstärkeren.
Reichweite ist Macht, und die wird Hand in Hand von Regierungen, Medien und US-Tech-Riesen reguliert.
Frau Faeser sollte mal besser die Finanzströme von Correktiv untersuchen und abstellen.
So eine dermaßen vorsätzlich falsche und unseriöse Berichterstattung darf in einer Demokratie nicht geduldet werden.
Frau Fäser wird da bestens Bescheid wissen. Schließlich ist sie Teil dieser politisch/medialen Clique. Die wird sich hüten irgendwas über die Geldquellen und über die Machenschaften dieser dubiosen Correctiv-Connection auszuplaudern. Schließlich arbeiten die in Fäsers Sinn, vielleicht sogar immer mal wieder in ihrem Auftrag!
Bin mir ziemlich Sicher das einer der Finanzströme direkt von Nancys Ministerium zu Correktiv führt.
Gibt ja auch mehr als nur einen Politiker der sich verplappert hat wenn es um die Finanzierung der Anitfa geht. Legendär ist da eine Künast Rede. Genauso wird es bei fff und der letzten Generation aussehen.
Die haben sich nämlich auch schon mehr als einmal verplappert und preisgegeben das sie nicht aus Altruismus und wegen dem Klimaschutz handeln sondern weil es so einen schönen saftigen Salär fürs auf die Straße kleben gibt.
Würde mich auf jeden Fall nicht wundern wenn die Mehrzahl der Demonstranten gegen rechts Langzeitstudenten und Pensionäre sind
Bitte nicht alle Rentner über einen Kamm scheren , ich bin einer und wähle die Schwefelpartei , schon länger .
Der Merkelsche Sozialismus wird weiter perfektioniert.
-Journalisten anrufen und briefen, was sie in sogenannten Krisensituationen berichten dürfen und was nicht: Check
-Die Bundesverfassungsrichter vor der Urteilsfindung zum Abendessen einladen und dabei eine flammende Verteidigungsrede halten: Check
-Richter bei „falscher Urteilsfindung“ selber verurteilen und Berufserlaubnis entziehen: Check
-Eine Woche vor Ausführung des Masterplans gegen den größten politischen Gegner mit den „Journalisten“ über das Vorgehen beratschlagen: Check
– usw.: Liste ließe sich fortführen
„Desinformation als legitim zu betrachten, sobald sie der eigenen Haltung entspricht, und andererseits das, was bestimmten Akteuren missfällt, als Desinformation zu kennzeichnen, ist ein überaus besorgniserregender Trend.“ – Pardon, nein, Sie satteln das Pferd von der falschen Seite auf.
Desinformation ist Neusprech für „Information, die uns nicht in den Kram passt, folglich ‚offiziell‘ Lüge“. Zum Schlüssenwort „Lüge“ gehört das Gegenstück ist „Wahrheit“.
Im Grundgesetz, der Verfassung, die unsere politische Welt bedeutet, kommen die Worte wahr und falsch nicht vor. Jede Information ist nicht mehr als das: Infomation. Wahr oder Falsch überantworten wir der Realität.
Die Begriffe „wahr“ und „falsch“ kennzeichnen Totalitarismus, nicht Demokratie. Zurück zu meinem Ausgangssatz: Meinung ist frei laut GG Art. 5.
Danke für die Information.
Aber die Wahrheit glauben die Meisten leider nicht.
nur noch Lug und Trug paßt in deren „Wltbild“
Der Artikel bringt sehr schön (wenn man die prägnante Beschreibung eines beklagenswerten Zustands überhaupt als sehr schön bezeichnen kann) den Status quo dieser Demokratie und unserer Kommunikations- und Diskussionskultur auf den Punkt. Jedes Wort ist (leider) nur allzu wahr. Das hätte ich noch in den Nullerjahren niemals für möglich gehalten – zumindest nicht in Deutschland.
„Wie gehen wir mit einer Informationsgesellschaft um, in der jeder mit einem Social-Media-Konto „Medienschaffender“ ist?“
Gar nicht. Wenn nur der publizieren darf, der einen qualifizierten Berufsabschluss nachweist, ist das alles gar kein Problem. Alles andre sind Sachen die man glauben kann oder nicht. Dann gehören Äußerungen auf X, facebook oder Instagramm dorthin wo früher die Sprüche an den Bahnhofstoiletten standen. Oder hat die früher jemand ernst genommen?
Und wenn Politiker heute X benutzen um Politik zu machen, dann wissen wir wohin ihre Politik gehört – ins Klo.
Bundeskanzler Scholz traf sich kurz vor „Geheimkonferenz“ mit Correctiv
https://www.nius.de/news/nius-exklusiv-bundeskanzler-scholz-traf-sich-kurz-vor-geheimkonferenz-mit-correctiv/668fc2a1-c615-47ec-9a02-b64b175fbffc
ohne Worte
Nach dem immer mehr bekannt wird, weitet sich der Skandal von Corretiv immer mehr zu einem politischen Ausspähskandal der Bundesregierung und dem Verfassungsschutz aus.
Wenn selbst Kanzler Scholz und andere Regierungsvertreter sich elf mal mit Correktiv zu Geheimtreffen getroffen haben, weiß man aus welcher Ecke der Hass und die Hetze gegen die immer stärker werdende AfD stammt.
Anstatt seröser Politik zu machen, glänzen die Ampel und ihre Handlanger mal wieder mit Lügen, Desinformation, frei erfundenen Geschichten, Hass und Hetze.
Die Ampel braucht sich nicht zu wundern, wenn sie keiner mehr wählt.
In ihrem letzten Interview, kurz vor ihrem Tod, meinte Margot Honecker: “ Wenn ihr glaubt, dass der Sozialismus untergegangen ist, dann täuscht ihr euch aber gewaltig“.
Die Gute, hat sie was geahnt, oder schon gewußt ?
Nein, die Hauptschuld tragen nicht die Bündnis-Grünen-, die SPD- oder FDP-Politiker. Nein die Hauptschuld tragen die Mitläufer (wieder einmal!) der CDU/CSU oder anderer demokratischer Organisatoren wie auch die Kirchen. Aus fehlinterpretierten Aussagen – nein nicht irgendwelcher Konservativen, sondern der selbst schon hineininterpretierten Aussagen der Politiker der erstgenannten Parteien und der Medien – werden Mauern aufgebaut, die jegliche kommunikativen und sogar echten Berührungen verhindern und als kriminell brandmarken sollen – gefährlich wie der Kontakt mit einem Krankheitsvirus, eventuell auch eine Folge oder sogar Aufgabe der Pandemie! Wenn die CDU/CSU oder andere nichtlinke Parteien sich mehr zuhörten und bei sinnvollen Gesetzesvorlagen auch mit der AfD abstimmten, bräuchte die Bevölkerung keine starke Oppositionspartei in Form der AfD, sondern diese bliebe eine Minderheitenpartei. So aber gibt es für die Mehrheit der Bürger nur, die AfD zu einer absoluten Mehrheit-Partei zu verhelfen, um eine andere Politik zu bekommen! So aber hat das Bündnis90 nicht nur die Medien und die SPD, die FDP und die Linke sondern auch die CDU/CSU im Griff. Schlimm ist nur, dass das Bündnis90 von der Ausrichtung, der Gesetzgebung gegen die Bevölkerung, der gebrochenen Wahlversprechungen usw. die Partei einer modernen DDR2.0 ist!
Was, wirklich, die haben sich getroffen? Wo, wann, etwa in Potsdam? Wer war dabei? Wo war der Verfassungsschutz? Wer hat was notiert, bzw. abgehört. Gibt es bewegte Bilder? Wann werden die Inhalte veröffentlicht?
Meinen Sie das Geheimtreffen im Kanzleramt, wo man die Details der Aktion besprochen hat? Die CDU sollte ein Interesse an der Aufklärung zeigen, denn sie sind die nächsten, denen man versucht an den Kragen zu gehen; wobei das eigentlich überflüssig ist. Die CDU steht mittlerweile so weit links, dass man sie getrost zu diesem „erlauchten“ Kreis zählen kann. Spätestens nach der Parteigründung der WU, wird das überdeutlich.
Das Tolle daran ist, dass man zur Diskreditierung keine bezogenen Fakten mehr braucht.
Man stelle Fakten vor, die in keinem Bezug zur Sache stehen, die beim Leser jedoch unangenehme Gefühle hervorrufen -das ist der Punkt.
Herr X ist Jahre nach dem verheerenden Weltkrieg geboren, so dass er den Nationalsozialismus nicht kennengelernt hatte. Wäre Herr X sonst ein glühender Mitläufer geworden? – Herr x bleibt uns weiterhin in seinen politischen Ansichten fremd, zumal wir diese nicht kennen, da er sich uns gegenüber niemals darüber geäußert hatte, warum wohl nicht? Es lässt Schlimmes erahnen.
All die Vorwürfe treffen aber auch auf den gesichert linksextremen Focus und die SZ zu. Wenn Scholz seine Finger darin hat, ist er als Kanzler untragbar. Schon aus diesem Grund müssen die Fakten vor Gericht geklärt, die Zeugen unter Eid vernommen werden; inklusive Staatsolaf.
Die AfD sollte einen Untersuchungsausschuss fordern.
Der Skandal kann nur beendigt werden, wenn auch die Geldgeber von „Correctit“ mindestens politisch zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Skandal wird nie beendet werden. Die Regierung hat sich zu weit ausn dem Fenster gelehnt. Die mediale Bombe ist doch schomn längst explodiert. Und was ist passiert? Nichts.
Was sollte die Regierung auch tun? Zugeben dass sie Millionen auf die Straße getrieben hat für einen gigantischen selbst inszenierten Hoax?
Das ist nur durch eine Maßnahme zu reparieren – sofortiger Rücktritt der Regierung.
„Der Verdacht der Hofberichterstattung schmälert nicht nur die Glaubwürdigkeit von Correctiv“. Wo kannman etwas schmälern, das es nicht gibt.
Nun ist nicht alles Gold in unseren Nachbarstaaten, aber wo bitte, gibt es ein ähnliches Gebaren? Gibt es das in Frankreich, das wahrlich nicht perfekt ist? Hetzt Macron einen Verfassungsschutz, den es so dort nicht gibt, auf Reconquete und Rassemblement National?
Wo anders bleiben Untersuchungshäftlinge unverhältnismässig in Haft?
Wo gibt es Nachsicht bei Hatecrimes (Attacke auf den jüdischen Studenten), sofern sie nicht „Rächts“ angelastet werden?
Wo gibt es einen so aufgeblasenen Öffentlichen Rundfunk, obwohl zur Pluralität verpflichtet, mit erheblichem Linksdrall?
Das Medium macht nicht die Nachricht. Daher sind die sozialen Medien auch nicht für die zunehmende Polarisierung des Diskurses, für Verrohungen oder Hetzkampagnen verantwortlich. Ebenso gibt es keine Falschinfornationen. Lügen und Täuschen gehört zum Geschäft der Kommuniukation seit es Medien gibt, das gab es schon in Antike im Zeitalter der Papyrusrollen. Im Zweiten Weltkrieg unterhielten beide Seiten Propaganda-Sender, mit denen, unterlegt von Big-Band oder Schlagermusik, die Zivilbevölkerung des Feindes demoralisiert und zur Fahnenflucht überredet werden sollte. Das findet heute in den sozialen Medien statt, ganz einfach, weil sie der Marktplatz für Nachrichten im 21. Jahrhundert sind.
Zu jedem Zeitalter gehört Medienkompetenz, das ist eine unabdingbare Holschuld des Bürgers. Interessiert sie ihn nicht oder ist er zu faul, wird er halt manipuliert – aber davor kann ihn kein Staat oder Gesetz schützen. Wenn es hier bei TE um den Krieg in der Ukraine geht, findet sich immer wieder das gleiche Muster: Russlandfreundliche (und/oder westfeindliche) Beiträge erhalten oft binnen weniger Minuten weit über über 50 Likes und mehr. Beiträge, die für die Ukraine Partei nehmen, oder den Westen, erhalten fast genauso viele Dislikes, neutrale dagegen bestenfalls zwei, drei Likes. Zur Medienkompetenz eines TE-Lesers, also Bürgers, gehört, das in Beziehung setzen zu können. Selten erhalten Leserbeiträge bei anderen Themen mehr als 10 oder 15 Likes, auch solche, die eindeutig pro-AfD sind. In die Höhe von russlandfrendlichen Beiträgen kommen sie nie, nicht annähernd. Was oder wer auch immer diese hohe Zahl an Likes für Beiträge, die Russland oder Putin unterstützen erzeugt – die beabsichtigte Wirkung ist, den Eindruck zu erzeugen, 90 % aller TE-Leser seien Russizisten – und damit die Mehrheit. Natürlich ist das Unsinn, auch wenn die Zahl der Putin-Freunde hier sicher höher sein mag als bei Spiegel Online – wir sind hier nicht bei Compact oder dem Anti-Spiegel. Man kann also Manipulation vermuten. ABER: Davor muss mich niemand schützen. Ich bin zwar gegen Russland, aber für die AfD. Und ich verzage auch nicht angesichts von 100000 Anti-AfD-Demonstranten in Berlin, und denke, „ganz“ Berlin hasst die AfD. Weil ich’s besser weiß. Und weil ich weiß, das 100000 eben nicht 3,7 Millionen sind, die in dieser Stadt leben. Ich erkenne Manipulation, wenn ich sie sehe. Diese Kompetenzen muss heute jeder haben. So, wie er beim überqueren einer Straße vorher nach beiden Seiten blickt.
Auch ich habe im laufe der letzten Jahre ein feines Gespür für Manipulation entwickelt. Glaubte manchmal, ich hätte den 7. Sinn. Gut zu wissen, daß es noch mehr Menschen mit dieser Sensibilität, gibt. Aber leider immer noch zu Wenige.
„Eine selbstkritische Kurskorrektur ist dringend vonnöten“. Lassen Sie mich raten – es wird nicht passieren. Da die Brandmauer nicht nur zwischen den Parteien besteht, sondern auch zwischen den System- und den Alternativmedien (so sie konservativ sind), wird das in den Systemmedien in ihre stets für solche Fälle zur Verfügung stehende Lücke fallen.
„Kampf gegen Rechts“? Wer ist den nun „Rechts“?
So mancher der meint links zu stehen, steht rechts wenn er sich umdreht,
oder wenn die Zeiten sich wenden.
Wichtig ist, rechzeitig sein Mäntelchen in den Wind zu hängen.
So mancher rote Linker möchte dann noch brauner sein als die Braunen,
während andere rote Linke sich an ihre braune Vergangenheitnicht mehr erinnern wollen.
Quelle: Stellungnahme des Abg. Wels für die Sozialdemokratische Partei
im Reichtag, vom 23.03.1933
Ist der sehr verehrte Herr Bundespräsident so geschichtlich unbeleckt,
wenn er was anderes behauptet „von deutscher Kriegschuld“,
als sein SPD Parteigenosse als Zeitzeuge aussagt ?
Für den Allerweltskonsumenten von Nachrichten, der sich über Tagesschau, heute und seine Tageszeitung hinaus keine weiterreichenden Informationen zu erlangen versucht, ist diese Medienlandschaft bereits Realität. Mit Steuergeldern, wird die Realität in entsprechend der Ideologie der Regierenden verbogen, die eben nicht für Freiheit und Selbstverantwortung stehen, sondern für Bevormundung und betreutes Denken, wie es die Anstalten des ÖRR oder die Tageszeitungen des SPD-Medienimperiums vorexerzieren. Seltsamerweise interessiert es praktisch niemanden, dass eine Partei in Deutschland über zahlreiche Redaktionsstuben die Stimmung im Lande zu ihrem Vorteil zu beeinflussen versucht. Während die andere über eine überwältigende Anhängerschaft im ÖRR verfügt und die dafür sorgen, dass Ausgewogenheit im Programm nicht vorkommt. Ist das ein legitimes Mittel der politischen Willensbildung oder sollte so etwas nicht unterbunden werden?
Die Ostdeutschen kennen das alles sehr gut! Einziger Unterschied: Damals sind freiwillig nur wenige, verirrte mit den Regierenden demonstrieren gegangen. Heute sind es scheinbar ein paar mehr – die Dekadenz hat scheinbar die Hirne vernebelt.
Das Ding ist: die heute wissen wirklich nicht, was sie tun. So uninformiert bzw. verbildet wie indoktriniert sind die tatsächlich!
Nach allem, was inzwischen ans Tageslicht gekommen ist, kann man Correctiv nicht als seriöse Nachrichtenquelle einstufen.
Das war eigentlich schon immer so. Das Kampfblatt der Antifa, gefördert von dieser gesichert linksextremen Regierung, braucht solche „Helferlein“. Es muss ja zumindest demokratisch aussehen.