Täglich werden wir mit Begriffen konfrontiert, die im Ergebnis einer als alternativlos gepriesenen Energiewende verwendet werden oder durch sie erst entstanden sind. Wir greifen auch Bezeichnungen auf, die in der allgemeinen Vergrünung in den Alltagsgebrauch überzugehen drohen – in nichtalphabetischer Reihenfolge.
K wie
Kohlekommission, die
Der Begriff ist lateinischen Ursprungs („comissio“) und steht für „Vereinigung“ oder „Verbindung“. Veraltet ist die Verwendung als Bezeichnung für „anvertrauen“ oder „beauftragen“. Kaum sagt man heute noch, jemand wolle etwas „in Kommission“ verkaufen. Dennoch fühlen wir uns bei der Kohlekommission irgendwie verkauft.
Selten gab es vor der Einsetzung einer Kommission so viel politisches und mediales Theater wie bei der nunmehr berufenen umgangssprachlich genannten Kohlekommission. Ihre offizielle Bezeichnung lautet „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ und könnte grundsätzlich für alles zuständig sein, was Wirtschaft und Gesellschaft betrifft. Regierungsamtlich soll damit gezeigt werden, dass man die Folgen zu berücksichtigen gedenkt, wenn Kohlestrom mit Terminsetzung verboten werden sollte.
Dem ökolinksgrünen Komplex schwebt vor, durch diese Kommission in Analogie zur Ethikkommission 2011 ein Kohleausstiegsgesetz mundgerecht begründet zu bekommen. Konnte man beim Atomausstieg noch auf manifestierte Angst vor dem Massentod setzen, funktioniert dies bezüglich des Kohleausstiegs nicht. Zum einen ist ein schneller Tod durchs Klima nicht abzusehen, zum anderen schwant auch den mit der Materie weniger befassten Mitmenschen, dass man neben der Kernkraft nicht auch fast gleichzeitig noch weitere knapp 40 Prozent des Stromaufkommens folgenlos plattmachen kann. Der Gedanke, mit einem deutschen Kohleausstieg die Welt retten zu können, lässt sich nicht wie beim Atom durch ein Panikinstrument stützen.
Sollte die Ethikkommission vor allem moralisch-philosophische Ansätze als Begründung für das Atom-Aus liefern, wird jetzt ein ganzheitlicher Ansatz gesucht, der alle Folgen berücksichtigt und Ökonomie und „Klimaschutz“ harmonisch eint.
Wurden die Stuhlreihen der Ethikkommission 2011 vor allem von Klerikalen und Geisteswissenschaftlern besetzt (die übrigens den Neubau von Kohlekraftwerken wegen wegfallendem Atomstrom für nötig hielten), soll nunmehr auch Fachverstand in der Kommission vertreten sein.
Das ist, wenn man die Zusammensetzung sieht, nur teilweise der Fall, aber Ziel ist ja auch ein politischer Konsens. Einer der vier Vorsitzenden ist Roland Pofalla, bei der Bahn offenbar unterbeschäftigt und für seine umgänglich sympathische Art bekannt. Er wird schon kommunizieren, wenn ihm eine „Fresse“ am Tisch nicht passt. Neben Matthias Platzeck und Stanislaw Tillich als ehemaligen Ministerpräsidenten von Kohleländern wird die Vorsitzendenrunde durch die nachhaltige Professorin Barbara Praetorius komplettiert. Sie arbeitete für das DIW, Agora Energiewende und besetzt derzeit einen Lehrstuhl für Umwelt- und Klimaökonomie. Ihr schlichtes Credo ist ein schnelles Kohle-Aus und Ersatz durch mehr Wind- und Sonnenstrom, also grüne Einfalt in Reinform.
Grüne Kommissare
Die Vertreter von Greenpeace, BUND und Artverwandte bilden den Background-Chor der CO2-fixierten „Abschalten“-Rufer. Es finden sich eine Gerechtigkeitsforscherin sowie Antje Grothus, die nebenbei Strom für Greenpeace-Energy verkauft und von einer Bürgerinitiative kommt. Die Rolle Professor Schellnhubers ist offensichtlich. Er ist für das ganz große Rad zuständig und wenn seine „Große Transformation“ schon nicht kommt, dann ist der deutschnationale Kohleausstieg aber das Mindeste. Eines eint die Phalanx der Ausstiegsbefürworter, abgesehen von den einschlägigen Politikern: Sie sind in keiner Weise demokratisch legitimiert und sorgen dafür, dass die Kommission nicht die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft spiegelt. Zudem sind Grüne, Greenpeace und Anti-Kohle-Initiativen bekannt für ihre unterstützende Toleranz gegenüber der Gewalt linksextremer Gruppen, die wie unlängst am Tagebau Hambach ihre Straftaten weitgehend folgenlos begehen können.
NGOs der anderen Seite (Pro Lausitz e.V., Unser Revier) hatten keine Chance zur Teilnahme.
Ziel der Anti-Kohle-Bank ist der schnellstmögliche Kohleausstieg, ungeachtet jeglicher Folgen. Sie will die Kommission in ihrem Krieg gegen die Kohle instrumentalisieren. Es herrscht die feste Überzeugung, mit Geld seien alle Probleme zu lösen, dieses sei in großen Mengen vorhanden und würde es auch immer bleiben. Beschwichtigungen, alles solle sozialverträglich ablaufen, werden konterkariert durch Forderungen zur Sofortabschaltung von sieben Gigawatt, was in den zum Glück unvollendeten Jamaika-Verhandlungen so gut wie ausverhandelt war.
Dass ein schnellerer Ausstieg umso teurer wird, ist für diese Fraktion kein Problem. Der wirtschaftliche Hintergrund von Braunkohletagebauen besteht aber darin, dass man diese nicht beliebig zeitnah herunterfahren kann. Würde zwangsabgeschaltet, gäbe es nicht die in den Betriebsplänen festgelegten Endreliefs der Gruben, die Basis für die Rekultivierung sind. Offene Tagebaue mit enormen Folgekosten für den Steuerzahler wären die Folge, denn die Betreiber könnten durch den eingestellten Geschäftsbetrieb auch kein Geld mehr für den toten Bergbau abführen.
An der anderen Seite des Tisches sitzen auch Realisten. Stefan Kapferer vom BDEW warnt vor dem sich abzeichnenden Kapazitätsmangel, ein Punkt, den Wirtschaftsminister Altmaier offenbar noch nicht zur Kenntnis genommen hat. Der fabuliert lieber über Offshore-Windkraftanlagen als „Kathedralen der Energiewende“ und möchte „Arbeitsplätze zu den Menschen bringen“. Realitätssinn geht anders.
Sachkunde bringt auch Michael Vassiliades mit. In seiner als Konsensgewerkschaft bezeichneten IG BCE ist mehr Energiewissen versammelt als in der ganzen Bundesregierung. Zudem ist hier bekannt, dass man im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interesse eine Kuh melken muss und sie nicht für eine global irrelevante Emissionsminderung schlachten sollte.
Wer die Musik bestellt, in diesem Fall abbestellt, muss zahlen. Wer politisch den Abschaltknopf in Anlagen drückt, die immer noch halbwegs am ramponierten deutschen Strommarkt klarkommen, muss für Ersatz sorgen. Das gilt nicht nur für entfallenden verlässlichen Strom, sondern auch für die wirtschaftlichen Folgen in den Regionen. „Ein Gigawatt für ein Gigawatt“ tönt es von dort und meint den Ersatz an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen.
Ahnungslose Abschalter
Politik schafft keine Arbeitsplätze, diese Weisheit ist so alt wie der Kapitalismus. Sie kann aber wohl Arbeitsplätze vernichten. 3.600 sind es deutschlandweit allein durch die so genannte „Sicherheitsbereitschaft“ von Braunkohlekraftwerken. In der Lausitz entfallen durch die Reservestellung eines einzigen 500-MW-Blockes zum Jahresende etwa 1.600 Stellen von direkt Beschäftigten und bei Dienstleistern. Dazu kommen Stellenverluste bei Bertelsmann, Siemens, Bombardier und der DB Instandsetzung. Spärlich blühende Landschaften im Osten beginnen zu welken.
Alle grünen Zukunftsträume bleiben dagegen ohne Termin. Wunschvorstellungen von baldigen Arbeitsplatzzuwächsen durch wie auch immer geartete Stromspeicher oder Wasserstoffinfrastrukturen oder E-Mobiliät oder Künstliche Intelligenz bleiben so fern der Realitäten wie eh und je. Ein gewisses Maß natürlicher Intelligenz wäre hilfreich.
Am Ende der Kommissionsarbeit soll eine Jahreszahl stehen. Medial geht es aber nur um CO2 und Arbeitsplätze. Die wichtigsten Punkte, Versorgungssicherheit und Strompreise, werden schmählich ignoriert. Die Realisten in der Kommission sollten weitere Jahreszahlen festschreiben lassen. Ab wann und in welcher Menge liefern die „Erneuerbaren“ verlässlichen Strom?
Das Kommissionsziel ist nicht weniger als eine Quadratur des Kreises. Wirtschaftliche Prosperität und „Klimaschutz“ sollen harmonisch geeint werden. Wie viele Arbeitsplätze entfallen pro eingesparter Tonne CO2 und sind an anderer Stelle staatlich finanziert zu schaffen? Wie hoch sind die CO2-Vermeidungskosten eines gewaltsam zu nennenden Ausstiegs? Weiteres Geld braucht die Finanzierung der Netzreserve, der systemstabilisierenden konventionellen Kraftwerke. Ab 2023 wird die Decke kurz.
Die fälschlich als „Klimaziele“ bezeichneten deutschen Emissionsziele für 2020 werden nicht erreicht, die für 2030 sind unrealistisch. Selbst wenn ein zügiger Kohleausstieg im Energiesektor kommen würde, fehlen die Minderungen im Bereich Gebäude und Verkehr. Die Abkehr vom Diesel und die Zuwendung zum Benziner werden die CO2-Emissionen steigen lassen. Gebäudedämmung funktioniert dauerhaft nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht per Befehl.
Egal, welche Minderungsziele verfügt werden, es fehlt die Angabe, wie viele Grad Erderwärmung wir damit vermeiden würden.
Das Jahr 2019 droht mit Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Schwere Zeiten für die Landespolitiker, die noch an der Macht sind.
Vielleicht hilft die Gründung einer Kommission gegen den Populismus naturwissenschaftlicher Gesetze, nicht eintretende Klimaprognosen und eine renitente Bevölkerung.
Frank Hennig ist Diplomingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung mit langjähriger praktischer Erfahrung. Wie die Energiewende unser Land zu ruinieren droht, erfährt man in seinem Buch Dunkelflaute oder Warum Energie sich nicht wenden lässt. Erhältlich in unserem Shop: www.tichyseinblick.shop



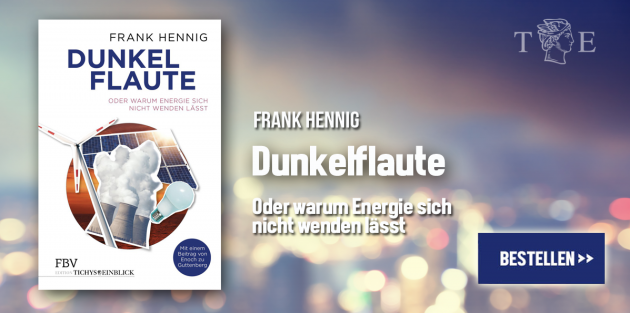
Liebe Leute,
ich kann ja verstehen, dass Sie sich darüber aufregen, dass die Erneuerbaren Energien so viel gekostet haben, doch nach nunmehr ca. 25 Jahren seit Einführung des damaligen Stromeinspeisegesetzes, hat die technische und wirtschaftliche Entwicklung dafür gesorgt, dass Strom aus Wind- und Solarenergie nun billiger ist als der Brennstoff für Steinkohlekraftwerke.
Also, selbst wenn man sich auf die krude Diskussion um eine angeblich fehlende Versorgungssicherheit ohne Atom, Kohle & Gas einließe, bliebe immer noch die Tatsache, dass der Strom aus Wind und Sonne billiger wäre als Kohle.
Selbst das direkte Heizen mit Strom ist unter diesen Umständen billiger als eine Gas- oder Kohlenheizung.
Doch ich gebe zu, dies gilt lediglich für die Gegenwart und die Zukunft von Wind- und Solarenergieanlagen.
Die derzeit bereits installierten Anlagen erhalten noch eine – leider zu üppige – EEG-Förderung und es wird auch noch 20 Jahre dauern, bis auch die letzte dieser Förderungen und damit auch ihre Finanzierungsquelle, die EEG-Umlage, verschwunden sein wird.
Ich weiß natürlich nicht, wie sich Herr Hennig die Zukunft der Energie vorstellt, aber ich kann gerne erläutern, wie das die Investoren sehen, die ich betreue:
1. Investitionen in Atom-, Kohle- & Gasenergie liefern nur noch Verluste. Diese können lediglich in den Stunden Geld verdienen, in denen wenig Wind & Sonne vorhanden ist. Die Anzahl solcher Stunden ist mittlerweile zu gering geworden, um davon leben zu können.
Das gilt vor allem für die Steinkohle und die Gaskraft, aber auch zunehmend für die Braunkohle.
2. Die von den Herstellern für das Jahr 2020 und 2021 vorgestellten Anlagen, die sich aktuell in der Prototypenentwicklung befinden, versprechen Gestehungskosten von unter 3 ct/kWh für Strom aus Wind- und Solarenergie. Aktuell sind es ca. 3,5 ct/kWh bei den kommerziell bereits verfügbaren Anlagen.
Damit wird die EEG-Förderung endgültig und nachhaltig überflüssig. Deshalb kalkulieren Investoren bereits ohne EEG-Förderung und nehmen nur noch die Vergütung am Strommarkt (Börse) als Maßstab für ihre Kalkulationen.
3. Neue Windenergieanlagen haben ca. 4.000 Volllastbenutzungsstunden und dadurch auch einen deutlich höheren sog. „Marktwert“ des produzierten Stromes als Altanlagen, die in der Vergangenheit teilweise mehr als 50% ihres Gesamtertrages nur in sehr windstarken Stunden von mehr als 45 km/h produziert haben.
Heute beträgt dieser Anteil nur noch ca. 20%.
Mit diesen Daten liefert ein Verbundkraftwerk bestehend aus einer Windenergieanlage, einer PV-Anlage, einer Batterie und einer Gasturbine/Gasmotor für die Residuallast sehr viel günstiger gesicherte Leistung und Energie als ein Kohlekraftwerk.
Während ein Steinkohlekraftwerk heute ca. 8,5 ct/kWh an Kosten verursacht, davon ca. 5 ct/kWh allein für Brennstoff und CO2, liefert das o.g. Verbundkraftwerk gesicherten Strom für nur 7 ct/kWh.
Brennstoffkosten werden dabei nur von der Gasturbine verursacht. Wenn die Gasturbine läuft, betragen diese derzeit ca. 8 ct/kWh, doch die Gasturbine wird nur für ca. 600 Volllastbenutzungsstunden beansprucht. Ihr Anteil an der Gesamtenergieerzeugung beträgt statistisch ca. 7%.
Wie funktioniert ein solches Verbundkraftwerk gemäß den langjährigen statistischen Wetterdaten:
An ca. 3.000 Stunden im Jahr ist der Bedarf gedeckt und die Überschüsse können eingespeichert, verkauft, anderweitig genutzt bzw. abgeregelt werden.
Die gespeicherten Überschüsse ermöglichen eine Versorgung ohne Gasturbine in weiteren 4.000 Stunden, in denen die jeweils aktuelle Erzeugung aus Wind- und Sonne allein nicht ausreicht, um die Versorgung aufrecht zu erhalten.
In den verbleibenden 1.760 Stunden ist eine „Zufütterung“ aus der Gasturbine oder dem Gasmotor notwendig, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Die Gasturbine funktioniert dann als sog. „Range Extender“ für die Batterie.
Ein solches Verbundkraftwerk könnte wie folgt aussehen:
1. 16,8 MW an Windkraft –> mit ca. 68 Mio. kWh an erzeugtem Strom
2. 16 MW an Solarkraft –> mit ca. 15 Mio. kWh an erzeugtem Strom
3. Batterie: Fähig um ca. 30% eines Tagesbedarfs zu speichern.
4. Gasturbine: Groß genug, um während eines 24 stündigen Betriebes bei Nennlast den notwendigen Energiebedarf an Strom zu decken. –> z. B. 7 MW Nennleistung bei einem Tagesstrombedarf von 244.000 kWh.
–> Aus der Gasturbine würden dann 4,2 Mio. kWh stammen.
Von der gesamten Erzeugung von 87,2 Mio. kWh können nur 58,1 Mio. kWh aus Wind und Solarenergie verwertet werden und die 4,2 Mio. kWh aus der Gasturbine, also insgesamt 62,3 Mio. kWh.
Mit einem solchen System kann ein elektrischer Output von ca. 10,2 MW zu jeder Zeit sichergestellt werden. Dieser Mindestoutput setzt sich wie folgt zusammen:
7 MW aus der Turbine, 5% als Mindestoutput aus der Windenergie und 2% Mindestoutput aus der PV-Anlage.
Hinzu kommt die Leistung, die die volle Batterie für 24 h halten kann.
Durch die Batterie ist es möglich, die 24-Stunden Durchschnittswerte der Wind- und Solaranlagen für die Berechnung zu verwenden, da die Batterie die Schwankungen in diesem Zeitraum ausgleicht.
Ein gesichertes 10,2 MW Verbundkraftwerk kostet in der Investition zwar ca. 2.800 Euro je gesicherter kW, aber es hat halt auch so gut wie keine Brennstoffkosten.
Deshalb ergeben sich bei den o.g. 62,3 Mio. kWh an „verwertbarem Strom“ Kosten von ca. 7 ct/kWh.
Mit den Kostensätzen, wie sie bei Wind, Solar und Batterien für das Jahr 2021 angekündigt sind, würden die Kostenansätze sogar auf unter 5,5 ct/kWh fallen (inkl. Kapitaldienst, Brennstoff für Turbine und sonstige Betriebskosten).
Darüber hinaus stünden ferner Überschüsse von 30% der Produktion aus Wind- und Sonne zur freien Verwertung, entweder an der Strombörse oder in der Sektorenkopplung und würden dann zumindest teilweise zusätzliche Erlöse produzieren.
Das Kostenargument ist also mittlerweile bei Wind- und Sonne hinfällig. Das gilt auch für gesicherte Leistung.
Insofern ist nicht mehr die Ökologie der Treiber der Entwicklung, sondern nur noch die Ökonomie, also Bloomberg & Co..
Strom aus Wind- und Solarenergie ist einfach viel billiger als Strom aus Kohle.
Na, dann wird ja alles gut. Wie viele Verbundkraftwerke sind schon im Bau? Nur zwei Anmerkungen: 4.000 Volllaststunden onshore sind illusionär. Der Strom wird nicht nach Gestehungskosten bezahlt, sondern nach Nachfrage. Bei Flaute ist der Preis hoch, aber die Windkraft kann nicht liefern. Das Gaskraftwerk wiederum hat zu wenige Betriebsstunden, um wirtschaftlich zu sein, zudem hohe Brennstoffkosten, die sich nur als GuD mit KWK erwirtschaften lassen. Trotzdem viel Erfolg mit den Verbundkraftwerken, vielleicht klappts ja.
Lieber Herr Henning,
der beste Verbund, das wissen Sie doch selbst, ist der über das öffentliche Stromnetz. Deshalb wird man den Verbund auch nur selten physisch an einem Ort darstellen sondern meist vertraglich, sofern dies notwendig sein sollte, was wiederum von der Regulatorik abhängt.
Bzgl. der 4.ooo Volllaststunden für Windenergieanlagen:
Die Siemens SWT 142 mit 3,15 MW an Leistung liefert an einem Standort mit 110% des Referenzertrages laut EEG ca. 4.200 Volllastbenutzungsstunden.
Hierfür ist eine Nabenhöhe von 165m notwendig. Der Rotordurchmesser beträgt 142 m. Die mittlere Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe beträgt dann an diesem Standort 7,5 m/s.
Ein solcher Standort entspricht der Güte eines Standortes in der Nähe von Bremen. Alle Standorte nördlich davon sind in der Regel besser und liefern entsprechend auch mehr Energie.
Für diese „besseren Standorte“ gibt es die o.g. Anlage auch mit einer Leistung von bis zu 4,2 MW. Diese Variante hat dann zwar etwas weniger Volllastbenutzungsstunden aber trotzdem einen deutlich höheren Ertrag je Anlage.
Der Grund für diese hohen Zahlen ist folgender:
Noch in 2012 hatten Windenergieanlagen einen Rotordurchmesser von 90m bei 3 MW Leistung. Das entspricht einer überstrichenen Rotorfläche von 2,12 qm/kW. Gleichzeitig lag die mittlere Nabenhöhe bei ca. 105 m.
Die o.g. Siemensanlage hat eine überstrichene Rotorfläche von ca. 5 qm/kW und eine Nabenhöhe von 165 m . 10m mehr Nabenhöhe bedeuten ca. 5% mehr Ertrag, also bei 60 m mehr Nabenhöhe sind das ca. 30% mehr an Ertrag.
Ergo ergibt sich folgendes (5/2,12) x 1,3 = 3,066.
Das Ergebnis heißt, dass die Daten der Siemensanlage den Ertrag gegenüber dem Vergleichsmodell (Vestas V 90 3MW) verdreifachen.
In der Realität ist es tatsächlich etwas weniger, weil die Siemensanlage bereits bei 10 m/s fast ihre Nennleistung erreicht. Da liegt die Vergleichsanlage noch bei ca. 35% ihrer Nennleistung.
Hier verzichten neue Anlagen also auf Zusatzerträge bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten.
Offshore schaffen heutige Anlage mit deutlich kleineren spezifischen Rotordurchmessern bereits 4.500 Volllastbenutzungsstunden und demnächst sogar bis zu 5.500 (Haliade X von GE – verfügbar ab 2021 mit 12 MW Einzelleistung und einem Rotordurchmesser von 220m).
Bzgl. des Strompreises haben Sie natürlich völlig recht. Die Gestehungskosten interessieren den Stromkunden nicht, sondern nur das, was er für den Strom zu zahlen hat.
Deshalb folgendes: Der Marktwert (das ist das was Sie oben meinen) der Windenergie-Bestandsanlagen im Jahr 2017 betrug 2,88 ct/kWh. Das ist der volumengewichtete Jahresmittelwert für Windstrom. Bei der Solarenergie lag dieser Wert bei 3,2 ct/kWh. Die Solarenergie hat einen höheren Marktwert.
Die neuen Windenergieanlagen haben aber ein völlig anderes Erzeugungsprofil.
Gegenüber dem Durchschnitt des Anlagenbestandes haben neue Windenergieanlagen einen ca. dreifachen Ertrag je installiertem kW.
Für den Anlagenbestand bis Zubau in 2013 gilt: 50% des Stroms werden zu Zeiten niedriger Strompreise erzeugt.
Bei neuen Anlagen sind das nur noch ca. 20%. Dementsprechend ist der Marktwert neuer Anlagen mit großem Rotor und einer sehr hohen Nabenhöhe sehr viel größer. Er liegt derzeit bei 3,2 ct/kWh also in der Nähe der Solarenergie.
Wie Sie aber wissen sind die aktuellen Marktpreise für Steinkohle und Gas ruinös. Beide können davon nicht einmal ihre Brennstoffkosten bezahlen, was dazu führt, dass die Steinkohle letztes Jahr ca. 20% ihres Erzeugungsvolumens verloren hat. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich weitere 20% werden.
Dementsprechend füllt sich auch die Kraftwerkstilllegungsanzeigenliste der Bundesnetzagentur.
Was die Gaskraft betrifft: Die lohnt sich derzeit weder als GuD noch als offene TKW.
Allerdings besitzen Gaskraftwerke die notwendige Flexibilität für den zukünftigen Markt. Deshalb kommt die derzeitige Preisspreizung, die man zunehmend im Markt sieht, vor allem den Gaskraftwerken zu Gute. Allerdings gilt dies vor allem im Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr sind die Preise für den Einsatz von Gas meist zu niedrig.
In einem Umfeld in dem die Erneuerbaren jedes Jahr ca. 20 TWh von den fossilen Energieträgern übernehmen, hat Kohle keine Überlebenschance mehr und wird immer mehr Erzeugungsvolumen an die Wind- und Solarenergie und auch an die Gaskraft verlieren.
Rein rechnerisch wäre es mit der Steinkohle bereits in 4 Jahren, also per April 2022 vorbei, aber durch den Atomausstieg und die „Braunkohlereserve“ hält diese wahrscheinlich noch bis April 2025 durch.
Dies gilt aber nur, sofern keine vorzeitigen Stilllegungen bei der Braunkohle erfolgen, wovon ich aber stark ausgehe.
Die Preise für Steinkohle sind ruinös? Jaja, so kann man das darstellen. Ruinös ist eher die gesetzliche Vorrangeinspeisung von EE-Strom. Kein Verbraucher würde ihn kaufen, da er nicht regelbar ist und der Nachfrage folgen kann und sogar noch mit zusätzlichem Geld ins Ausland verklappt werden muss, wenn an verbrauchsschwachen Tagen der Wind etwas stärker weht. Die Verbraucher zahlen natürlich mit ihrem Strompreis in solchen Fällen die Vergütung nach EEG plus die Kosten der Verklappung. Aber wenn dann mal eine länger Dunkelflaute ist, so wie genau vor einem halben Jahr vom 15. Dezember früh bis 22. Dezember am Abend (8 Tage), dann braucht es Backup-Kraftwerke in erheblichen Größenordnungen, deren Kosten einschließlich der Kosten des Standbys den Kosten der Erneuerbaren hinzugerechnet werden müssen.
Wenn die Wasserwerke nur liefern würden, wenn sie gerade Lust hätten, könnte man sich zu Hause ein paar Wassereimer hinstellen. Stromeimer gibt es noch nicht, auch nicht bezahlbare Batterien mit ausreichender Kapazität. Es braucht immer das Backup an Erzeugungskapazitäten. Ein doppeltes Stromerzeugungssystem aber als Fortschritt anzusehen, ist befremdlich.
Und es ist ein Propagandatrick, Großkraftwerke, welche bei einer Lebensdauer von gut 40 Jahren kontinuierlich preiswerte Energie erzeugen als Dinosaurier zu beschimpfen, während Kraftwerke, deren Erzeugung vollständig wetterabhängig ist, die unsere Landschaft verschandeln, Acker verbrauchen, Vögel töten und krankmachenden Infraschall erzeugen,als innovativ zu bezeichnen. Das technische Prinzip der Windkraftanlagen ist uralt. Keiner hat es mehr genutzt, bis das Volk dazu verdonnert wurde, deren Strom abzunehmen und zu bezahlen – nicht wenn er auch gerade gebraucht wird, aber immer dann, wenn er zufällig produziert wird.
Volle Zustimmung, Herr Lange.
Was mich ein bisschen irritiert, ist das geringe Interesse an diesem Thema, auch hier im Forum.
Wer sich mit dem Thema beschäftigt, erkennt die ruinösen Tendenzen dieser „Energiewende“ für die Bevölkerung (Strompreise steigen unaufhaltsam) und unserer Gesamtwirtschaft (keine zuverlässige Stromversorgung mehr).
Ich halte das für noch gefährlicher wie die derzeitige Migrationswelle, der man relativ einfach Herr werden könnte, wenn man wollte.
Die Energiesituation dagegen steuert auf irreversible Zustände zu, die einem Angst machen.
Lieber Herr Geiselhart,
wenn man auf Leute wie Sie hören würde, dann würden wir heute noch in Höhlen leben.
Wir haben bereits 41,5% Erneuerbaren Strom in der Nettostromerzeugung der öffentlichen Versorgung.
In 1998 haben mir noch einige Netzbetreiber erklärt, dass bei 4% das Netz zusammenbrechen würde.
Sie sehen, das Netz funktioniert immer noch.
Falls es Sie tröstet: Die Ausfallsicherheit des Netzes wird in Zukunft größer sein als sie es jemals war.
Das liegt a) an den Speichern im Leistungsmanagement und b) an der extrem hohen Ausfallsicherheit der Erzeuger, da es sich um kleine redundante Einheiten handelt.
Problematisch für das Netz sind nur noch die Ausfälle großer Schaltanlagen oder Kabeltrassen.
Lieber Herr Lange,
Herr Hennig wird Ihnen sicherlich bestätigen, das am Strommarkt kein Mensch irgendetwas für gesicherte Leistung bezahlt. Dies gilt sowohl in allen Börsensegmenten als auch außerbörslich.
Durch die massiven Überkapazitäten, die wir haben, ist gesicherte Kapazität einfach nichts mehr wert.
Unser Strommarkt ist ein sog. „Energy only“ Markt. Man zahlt also nur für gelieferte Energie. Alles andere interessiert niemanden.
Ist das Angebot an Energie groß, so ist der Preis niedrig und umgekehrt.
Nur um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln:
Im gesamten Jahr 2017 gab es am sog. „Day Ahead“ Spot- Markt gerade einmal 1.367 Stunden von 8.760, wo Steinkohlekraftwerke die älter als 20 Jahre sind, ihre Grenzkosten (i.W. Brennstoff + CO2) hätten erlösen können.
Eine solch geringe Anzahl reicht nicht einmal, um die laufenden Betriebskosten abzudecken.
Deswegen geben mittlerweile auch fast alle älteren Steinkohlekraftwerke (Betriebsbeginn vor dem Jahr 2.000) auf.
Fossile Kraftwerke können in Zukunft nur dann noch etwas werden, wenn Sie es schaffen, ihr Geld innerhalb von ca. 1.000 Stunden zu verdienen. Mehr wird diesen Kraftwerken nicht bleiben.
P.S.: Ziel und Zweck des Einspeisevorangs für die Erneuerbaren ist erfüllt.
Aus meiner Sicht ist ein Einspeisevorrang nicht mehr notwendig, da die Grenzkosten der Erneuerbaren ohnehin bei „Null“ liegen. Das heißt, nur wenn fossile Energien mit negativen Preisen unterbieten, rutschen sie in der Merit Order vor die Erneuerbaren.
Unten der Link zur aktuellen Statistik über die geleisteten Volllaststunden der Windenergieanlagen. Offshoreanlagen in geringer Entfernung zu Küste erreichen 3.600 Stunden, Onshoranlagen 3.200 Stunden oder weniger. Konkret sind das in Norddeutschland 2.500 Stunden und im Binnenland 1.800 Stunden.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/224720/umfrage/wind-volllaststunden-nach-standorten-fuer-wea/
Lieber Herr Lange,
der Blick auf die Statistik ist immer nur ein Blick in die Vergangenheit.
Nehmen Sie also die o.g. Stundenwerte und rechnen Sie diese auf die aktuelle Technik hoch. Dann erhalten Sie auch die Werte, die ich genannt habe.
Ich habe von der aktuellen Technik gesprochen und nicht vom Technikmuseum.
Ich frage mich gerade, wie hoch die Narben bei Windstille stehen müssen. Ich versichere ihnen, weder durch meine Dachwohnung, noch um die vielen Narben, die ich vom Fenster aus beobachten kann, wehte in den letzten warmen Wochen Abens und Nachts die ersehnte Brise. Sicher ist also weder die Abkühlung noch die Stromversorgung durch den Wind. Und dunkel ist es auch noch zur selben Zeit.
Lieber Raimond,
Sie meinen sicherlich die Naben.
Warum erwarten Sie eigentlich, dass die Windenergie immer liefern kann? Bei der Kohle- und Atomenergie wird das doch auch nicht erwartet. Diese Dinger stehen ständig wegen irgendeiner Sicherheitsabschaltung oder einer größeren Revision.
Bei der Wind- und Solarenergie ist es völlig gleichgültig, wann diese ihre Energie liefern. Wichtig ist nur, dass diese Energie dann, wenn Sie geliefert wird, auch sofort verbraucht oder eingespeichert werden kann. Auch das Abregeln, wenn man zuviel liefert, ist o.k., solange das nicht mehr als 2% der Jahresproduktion betrifft.
Es ist lediglich die Aufgabe der Wind- und Solarenergie dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Brennstoff verbraucht wird.
Deshalb funktioniert eine Versorgung mit erneuerbaren Energien am besten, wenn nur ca. 80% der benötigten Jahresenergie aus Wind & Sonne stammen (egal wann und wie diese geliefert wird) und der Rest kommt dann aus der Ergänzungserzeugung, das sind Wasserkraft, Biomasse und Erdgas.
Kohle und Atom finden hier keinen Platz mehr, weil dies „Volumenerzeuger“ sind, also sog. Grundlast oder Mittellastkraftwerke, die niemand mehr braucht.
Wenn er Wind dann nicht weht, so wie die letzten Tage, dann scheint die Sonne (sie scheint auch bei bewölkten Himmel!) und wenn die Sonne nicht ausreicht, dann müssen Speicher und die Ergänzungserzeugung liefern.
Wichtig ist hierbei nur, dass die Ergänzungserzeugung möglichst wenig Energie im Jahresablauf liefern muss, aber in der berühmten Dunkelflaute wird natürlich fast der gesamte benötigte Strom aus der Ergänzungserzeugung kommen.
Solange das nicht öfter als 15 – 20 mal im Jahr vorkommt, sehe ich da überhaupt kein Problem.
Kleiner Hinweis: Die Dunkelflaute kann es nur von Oktober bis März geben. In allen anderen Monaten ist die Solarkomponente zu stark und der Bedarf zu schwach dafür.
Zwar kann auch hier mal der größte Teil aus der Ergänzungserzeugung stammen, aber der max. Leistungsbedarf ist um ca. 20 GW kleiner.
@notname
Ja, natürlich meinte ich die Naben. 😉
Ich erwarte nicht, dass WKA immer Strom liefern können. Bei Kohle- und Atomenergie dagegen sehr wohl, denn diese „Dinger“ stehen weder ständig und schon gar nicht alle gleichzeitig. Letzteres ist sogar der entscheidende Unterschied zu den WKA und PVA.
Sie behaupten, es sei gleichgültig, wann Wind- und Solarenergie Strom liefern – knüpfen dies allerdings an die Bedingung, dass dieser genau dann auch verbraucht oder gespeichert werden kann. Und genau diese Bedingung ist eben weder jetzt erfüllt, noch wird sie das in absehbarer Zeit sein.
Da es keinen nennenswerten Speichertechnologien gibt, die über Tage oder gar Wochen andauernden Flauten überbrücken können, ist für Deutschland ein 80%iger Anteil an erneuerbaren Energie über das gesamte Jahr noch sehr lange eine Utopie.
Wenn Sie meinen, KKW und AKW braucht niemand mehr, sollten sie mal die Seite agora-energiewende.de besuchen und die „Konv. Kraftwerke“ theoretisch abschalten.
Dort können sie auch sehen, das Nachts PVA gar keinen und bei bewölktem Himmel nur einen Bruchteil der Nennleistung liefern. Betrachten Sie bitte auch den Jahresüberblich. Sie werden sehen, dass der Wind weitaus mehr als nur 15-20 Mal im Jahr pausiert. Sie können ja mal die Täler abschätzen, in denen sämtlich WKA Deutschland weniger als 10% ihrer installierten Leistung einspeisen. Ob 20 GW aus Ergänzungserzeugung diese Lücken auch nur annähernd schließen können, wage ich zu bezweifeln.
Lieber Herr Raimond,
Strom aus Wind & Sonne kann derzeit immer und zu jeder Zeit sofort verbraucht oder abgeregelt werden. Das ist auch anders gar nicht möglich, denn sonst wären die Beträge zur Entschädigung der abgeregelten Ökostromproduzenten deutlich höher als sie es derzeit sind.
Wieviel Strom abgeregelt wird, können Sie dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur sehr genau entnehmen. Der restliche Ökostrom wird derzeit vollständig und zeitgleich verbraucht oder bei der PSW eingespeichert. In jedem Falle bekommt der Betreiber der WKA oder der PVA eine Vergütung für tatsächlich abgenommenen Strom.
Sie dürfen mir aber gerne zeigen, wo etwas anderes bewiesen wird.
Ferner möchte ich doch festhalten, dass fossile Energieerzeuger natürlich ihre Leistung runter zu fahren haben, wenn Wind- und Sonnenstrom vorhanden sind. Dies passiert auch regelmäßig aus zwei Gründen:
1. Weil Strom aus Wind & Sonne, so wie er an der Börse angeboten wird, immer deutlich billiger ist als Strom aus anderen Quellen. Das liegt daran, dass Wind und Sonne keine Grenzkosten haben, also mit „Null“ Euro angeboten werden.
2. Es gibt immer noch einen Einspeisevorrang für Erneuerbare. Insofern haben fossile Kraftwerke abzuregeln sobald es eng wird.
Ferner zu den Speichern: Es wird niemals Speicher geben, die hier Strom über Wochen speichern. Das wäre wirtschaftlicher Humbug und wird deshalb auch nie geschehen. Die Aufgabe der Speicher ist nur das Leistungsmanagement im Tagesgang, also von 00:00 Uhr – 24:00 Uhr. Hier ist es die Aufgabe der Speicher, zwischen Stunden mit Unter- und Überdeckung auszugleichen. In der Regel wird dann nachts eingespeichert und tagsüber wieder ausgespeichert. Im Sommer wird es auch tagsüber zu Einspeicherungen kommen.
Bei dieser Gelegenheit übernehmen die Speicher automatisch auch die Primärregelung.
Außerdem gleichen Speicher auch eine ungleichmäßige Stromerzeugung aus Wind und Sonne im Verlauf des Tages aus.
Ferner sorgen die Speicher dafür, dass wir keine „Ergänzungserzeugung“ von mehr als 70 GW benötigen, denn die Speicher übernehmen die Abdeckung der Leistungsspitzen zwischen 07:00 – 22:00 Uhr.
Bitte verwechseln Sie hier aber Leistung nicht mit Energie.
Für die Aufgaben der Speicher im Tagesgang reichen ca. 160 GWh (160 Mio. kWh) an Speicherkapazität, wovon ca. 50 GWh bereits installiert sind.
Zusätzlich zu Wind und Sonne bedarf es allerdings einer „Ergänzungserzeugung“ für die täglichen „Energielücken“, sobald diese auftreten. Die benötigte Energie muss täglich bereitgestellt werden, notfalls durch rechtzeitige Inbetriebnahme der „Ergänzungserzeugung“.
Auch hier bitte nicht Leistung mit Energie verwechseln. Bei der „Ergänzungserzeugung“ geht es nur um Energie und nicht um Leistung.
Diese Ergänzungserzeugung wird aus Wasserkraft, Biomasse und Gaskraft bestehen. Sie wird eine Gesamtleistung von bis zu 70 GW haben aber nur auf eine durchschnittliche Auslastung von ca. 1.700 Volllastbenutzungsstunden im Jahr kommen, wobei ca. 2/3 der gelieferten Energie aus Wasser und Biomasse mit zusammen ca. 22 GW an Leistung stammen werden. Die restlichen 48 GW an Leistung werden aus Gas- und Ölkraftwerken kommen, mit einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 700 Volllastbenutzungsstunden.
All dies gilt unter der Annahme eines Gesamtstrommarktes von ca. 600 Mrd kWh (600 TWh).
Sollte der Markt größer werden, so steigen auch die o.g. Zahlen analog.
Atom- und Kohleenergie haben in diesem System keinen Platz, weil Atom- und Kohle viel zu träge sind. Sie lassen sich nicht 10 mal im Jahr für eine oder zwei Wochen mal ausschalten.
Atom- und Kohlekraftwerke sind für die Grund- und Mittellast gebaut und taugen nicht als Lückenfüller in der Spitzenlast.
Grund- und Mittellast wird es aber in Zukunft nicht mehr geben, sondern nur noch Tage mit Wind und/oder Sonne und Tage ohne Wind und/oder Sonne.
Einen solchen Betriebsmodus vertragen Atom und Kohle jedoch nicht.
Was Sie schreiben, ist zurzeit und noch lange, lange in der Zukunft ein schöner, grüner Traum. Sämtliche solcher Projekte bisher funktionieren nur mit massiven Subventionen in sehr kleinem Maßstab und sind nicht über das Forschungsstadium hinaus. Von dem Flächen- und Landschaftsverbrauch solcher Lösungen, wenn sie denn in großem Maßstab umgesetzt würden, gar nicht zu reden. Schöne neue Energiewelt…
Lieber Drstiehl,
was ich geschrieben habe ist kein Traum, sondern die derzeitige Realität am Markt.
Wenn Strom aus Wind und Sonne weniger kostet als die Steinkohle für die gleiche Menge Strom kosten würde, dann ist die Steinkohle verloren.
Das ist leider seit letztem Jahr der Fall.
Im Übrigen werden wir zum Ende des Jahres bereits 60 GW an installierter Windenergieleistung haben und für meine „schöne neue Welt brauche ich nur 100 GW plus das laufende RePowering nach 20 Einsatzjahren.
Das bedeutet: Ohne Schutzmaßnahmen ist die Steinkohle spätestens in 2025 tot. und spätestens in 2034 hat auch die Braunkohle keine Chance mehr.
Die Sicherung von Verfügbarkeit und Leistung ist auch heute schon möglich.
Wir haben bereits 29 GW an Gaskraftwerken, 6,4 GW an Wasserkraft (inkl. NordLInk) und 7,4 GW an Biomasse.
Mit der dann eher schlechten Lückenfüllung die auch die Kohle noch eine Zeitlang betreiben kann, sollten wir bis 2033 klar kommen.
Bzgl. Speicher: Wir brauchen natürlich bis zum Jahr 2033 ca. 160 GWh an Speichern für das Leistungsmanagement im Tagesgang. Auch hiervon haben wir bereits 50 GWh und bekommen mittlerweile jedes Jahr mehr als 0,5 GWh hinzu, wobei diese Zahl pro Jahr um ca. 50% steigt.
Ergo: Zur Zeit ist alles im „grünen“ Bereich.
Lieber notname, Sie begehen den immer gleichen Fehler der Energiewendebeseelten: Sie setzen die installierte Leistung der „Erneuerbaren“ mit der tatsächlich erbrachten Leistung gleich. Die 60GW installierte Leistung der Windräder sind nur 12GW „wert“, d.h. die Verfügbarkeit beträgt 20%.
Bei PV sind es sogar nur 10%.
Es ist deshalb sinnlos, mit Ihnen zu diskutieren, da Sie von völlig falschen Prämissen ausgehen.
Lieber Herr Geiselhart,
die 60 GW an Windenergie sind, falls Sie die Leistung meinen, nur ca. 3 GW wert, also 5%. Für alles weitere braucht man eine Wetterausfallsicherung.
Falls Sie aber die Energie meinen, in o.g. Fall den sog. „Kapazitätsfaktor“, so liegt dieser für den aktuell installierten Anlagenpark bei ca. 23%.
Das wären nach Ihrer Lesart wahrscheinlich 23%.
Und? Was wollen Sie mir damit sagen?
Als kleine Hilfe für Sie: Der o.g. Wert repräsentiert einen Anlagenpark mit Errichtung ab 1997 bis heute.
Würden Sie nur eine Anlage nehmen, die Stand der heutigen Technik ist, so läge der „Kapazitätsfaktor“ bei mindestens 42%, denn alles andere hat in der EEG-Auktion keine Chance mehr.
Offshore- Anlagen erreichen mittlerweile sogar bis zu 60% (Heliade X von GE).
Also, bitte beachten, dass auch die Windenergie nicht mehr mit Doppeldeckern fliegt.
Albert Einstein: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“
Auf der Insel Pellworm hat die Elite der deutschen Wissenschaft und Energiewirtschaft so ein „Leuchtturmprojekt der Energiewende“ bereits ausprobiert. Ein Hybridkraftwerk aus Windrädern, Solarmodulen und Biogasanlage (ist ja auch ein Gaskraftwerk) wurde mit Batteriespeichern kombiniert und erzeugte das Dreifache des Inselbedarfs an Strom, nur leider nicht immer, wenn er gerade gebraucht wurde. Ohne Verbindung zum deutschen Stromnetz wären da öfter mal die Lichter ausgegangen. Aber man kanns natürlich noch mal versuchen und noch mal und noch einmal …
https://ruhrkultour.de/pellworm-das-ziel-der-autarkie-wurde-verfehlt/
Clevere Investoren, wie z.B. Warren Buffet, verstehen den Sinn von Investitionen in Anlagen zur Erzeugung sogenannter Erneuerbarer Energien sehr gut: „I will do anything that is basically covered by the law to reduce Berkshire’s tax rate. … „For example, on wind energy, we get a tax credit if we build a lot of wind farms. That’s the only reason to build them. They don’t make sense without the tax credit.“ Sinngemäß sagt er, dass Windparks sinnlos sind ohne die Steuergutschriften. (Tax credits, also Steuergutschriften, sind die in den USA übliche Form der EE-Förderung)
https://www.usnews.com/opinion/blogs/nancy-pfotenhauer/2014/05/12/even-warren-buffet-admits-wind-energy-is-a-bad-investment
Ja, ja, immer wieder kommen die Leute mit Pellworm.
Das ist ungefähr so, als würde Sie sagen, das kein Mensch ein Mobiltelefon ohne Tastatur kaufen wird, weil das bis 2008 auch nicht funktioniert hat.
Gleiches gilt für die Fa. Kodak. Die haben auch behauptet, dass Digitalkameras Humbug seien.
Frage: Bemerken Sie die Ähnlichkeit?
Das wichtigste, was bei der Autarkie berücksichtigt werden muss, ist in Pellworm nicht passiert.
Man muss täglich für eine ausgeglichene Energiebilanz sorgen, auch bei Dunkelflaute.
Das ist nur möglich, wenn das „Gaskraftwerk“ in Dauerleistung die alleinige Versorgung technisch und logistisch für mindestens drei Wochen übernehmen könnte.
Wird das beherzigt, so funktioniert auch die Inselanlage.
Wie auch immer, falls Sie mehr als 10 GWh im Jahr verbrauchen, können Sie bei mir eine Inselanlage mit der Garantie kaufen, dass diese sie immer versorgen wird, gleich bei welcher Wetterlage.
Ihr Zitat: „Strom aus Wind- und Solarenergie ist einfach viel billiger als Strom aus Kohle.“
Sie vergessen, die notwendigen Kosten für Speicher, neue Netze, PtG-Anlagen, Backup-Kraftwerke usw. dazuzurechnen. Ohne diese „Erweiterungen“ ist Wind/PV-Strom nutzlos. Allein die Speicherkosten werden mit mehr als einer Billion Euro angesetzt, was ein mehrfaches der Stromgestehungskosten ausmachen würde.
Die von Ihnen angeführten 4000 Volllaststunden für Onshore-Turbinen werden höchstens in feuchten Träumen erreicht, derzeit liegen wir bei 1400-2200 VLS.
Schwachwindräder sind reine Trickserei, hier werden riesige Nabenhöhen und Rotorendurchmesser mit schwachen Generatoren kombiniert, die erzeugen zwar schon bei weniger Wind Strom, kommen aber auch bei relativ geringen Windstärken an ihre Grenzen.
Herr notname, Ihre Szenarien sind also reine Wunschszenarien, weit von der Realität entfernt.
Lieber Herr Geiselhart,
mein von Ihnen zitierter Satz gilt inkl. der notwendigen Ergänzungsleistungen und des Speichers.
Für das Jahr 2017 hatten wir in der Tat nur 1.840 Volllastbenutzungsstunden (On- und Offshore), doch hierin sind alle Anlagen ab dem Baujahr 1997 versammelt.
Wenn Sie etwas über die Leistungsfähigkeit des Zubaus der letzten drei Jahre erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen folgendes:
Nehmen Sie die Erträge der Windenergie per Ende 2018 und ziehen davon die Erträge per 2014 ab. Dann teilen Sie diese Differenz durch den Zubau der Jahre 2015 bis 2018. Wenn Sie das tun, werden Sie bei ca. 3.300 Volllastbenutzungsstunden landen für den Anlagenzubau ab 2015
Dabei handelt es sich auch hier um Anlagen, die nicht mehr Stand der Technik sind. Was in 2018 gebaut wird ist technisch der Stand von 2015, nur selten mal der Stand von 2016.
Alle Daten, die Sie für die genannte Berechnung brauchen finden Sie unter http://www.energy-charts. de oder bei der Netzagentur, bzw. den Netzbetreibern.
Lieber notnome, merken Sie eigentlich, welchen Unsinn Sie hier schreiben? Was glauben Sie, was mich die „Gestehungskosten“ eines KW Strom interessieren? Ungefähr soviel wie die VW-Selbstkosten zur Herstellung eines VW Golf. Mich interessiert, daß die EON von mir 30 Cent je Kwh haben will. Alles Andere ist mir völlig schnurz. Meinetwegen können Sie auch sofort alle restlichen AKW abschalten und die KKW gleich mit. Aber kommen Sie mir dann nur nicht damit, daß ich bei Dunkelflaute mein Notstromaggregat anwerfen muß. Ich wohne auf der Etage – hab also keins. Darf ich Ihnen dann die Rechnung für die Auffüllung meines abgetauten Gefrierschrankes senden?
Können Sie und Ihresgleichen nicht einfach woanders hingehen, dort Ihren grünen Traum weiter träumen und sich dort Ihrer Rechenkunststücke erfreuen? Warum müssen Sie das ausgerechnet in einem Land tun, das weder mit übermässig viel Wind noch mit übermässig viel Sonnenschein gesegnet ist? Und wenn Sie denn diese Freundlichkeit besässen, vergessen Sie bitte nicht, Herrn Schellnhuber mitzunehmen.
Lieber Bernhard F.,
Vorschlag Nr. 1: Wechseln Sie zu meinem Anbieter. Der nimmt nur 28 ct/kWh.
Ansonsten haben Sie natürlich völlig recht. Die Kosten des Stroms beim Großhandelseinkauf machen auf Ihrer Rechnung nur einen kleinen Teil aus. In der Regel sind das ca. 4 ct/kWh zzgl. MWSt.
Den Hauptbrocken machen die EEG-Umlage und die Netze inkl. Netzbetrieb aus.
Die EEG-Umlage allein sind bereits 6,79 ct/kWh zzgl. MWSt.
Genau wie bei der EEG-Umlage sind auch die Netzentgelte für Privatleute völlig überhöht, weil nur Private und Gewerbe beides bezahlen. Die Großindustrie zahlt meist weder EEG-Umlage noch Netzentgelte.
Dadurch nehmen 40% des verbrauchten Stroms nicht an der allgemeinen Umlage teil.
Ob das sinnvoll oder gerecht ist, möchte ich mal nicht kommentieren.
Wie auch immer: Inkl. MWSt. zahlen Sie für die EEG-Umlage ca. 8,1 ct/kWh, allerdings fällt die EEG-Umlage seit letztem Jahr (in 2017 lag sie noch bei 6,88 ct/kWh zzgl. MWSt.).
Sie wird aus drei Gründen auch weiterhin fallen:
1. Es verschwinden derzeit mehr Förderausgaben aus der Förderung als neue hinzukommen. Das liegt an Altanlagen, die nach 20 Jahren keine Förderung mehr erhalten. Allein bis 2025 sind ca. 20.000 MW betroffen.
Ferner liegt es daran, dass die EEG-Vergütung für die Windenergie im letzten Jahr halbiert wurde, von 8 ct/kWh auf 4 ct/kwh. Dadurch hat sich der Abstand zum Marktpreis von ca. 5,12 ct/kWh auf 1,12 ct/kWh reduziert (Marktpreis 2017 = 2,88 ct/kWh). Es wird bei neuen Anlagen ab Genehmigung in 2017 also nur noch ca. 21% des alten Wertes gefördert.
Neben der Windenergie fällt auch die Vergütung für Solarenergie und Biomasse, allerdings nicht mehr ganz so stark (Hinweis: Die Vergütung der Solarenergie ist vom Zubau in 2011 auf den Zubau in 2018 um 90% gefallen, von ca. 46 ct/kWh auf 4,6 ct/kWh).
2. Der Strompreis an der Börse steigt.
Wenn der Preis z.B. um 1ct/kWh steigt, fällt die EEG-Umlage um ca. 0,56 ct/kWh zzgl. MWSt. Das liegt daran, dass bei höherem Preis die Förderung der Erneuerbaren Anlagen geringer wird, denn es wird über das EEG nur die Differenz zwischen Marktpreis des Stroms und der EEG-Vergütung ausgezahlt, die sog. „Marktprämie“.
3. Die Menge des produzierten Stroms steigt weiter an. Aus Gründen des Wirtschaftswachstums und aus Gründen der Sektorenkopplung.
Steigt die Umlagebasis für die EEG-Umlage, so verringert sich natürlich auch der Beitrag des einzelnen. Das gilt i. Ü. auch für die Netzentgelte.
Ansonsten kann ich zu den Netzentgelten noch keine Prognose machen. Diese müssten zwar eigentlich steigen, aber gleichzeitig ist von der EU die Befreiung der Industrie teilweise verboten worden, so dass es sein kann, dass die Netzentgelte sogar fallen, trotz derzeitiger Investitionen.
Auf EU-Ebene kämpft Altmaier um Fristverlängerung für die CO2-Ziele, weil Merkel nicht schon wieder Schlagzeilen in den Medien haben möchte, wenn sie die aktuellen Ziele nicht einhält. Das hat sie mit dem Atomausstieg vermasselt, jetzt muss Altmaier nachverhandeln.
Komischerweise weiß man auch bei den Stickoxiden seit mindestens 10 Jahren, dass die Grenzwerte in den Kommunen auch mit Euro 5 nicht eingehalten werden können. Da die EU sich einer Fristverlängerung verweigerte hat man sich als Beschuldigte nicht Merkel, sondern die Automobilindustrie ausgesucht. Hätte Merkel gewollt, hätte es sicher eine Fristverlängerung gegeben, andere hätten mitgezogen.
Diese Kommission ist ein eindeutiges Signal, sich einen großen Dieselgenerator plus 2000l Öltank (gefüllt) zu kaufen.
Ich gebe Ihnen Recht.
Diese Kommission ist so überflüssig wie ein Kropf, denn die Kohleenergie geht derzeit ohnehin unter. Die Steinkohle verliert jedes Jahr ca. 20 Mrd kWh an Erzeugungsvolumen an die Erneuerbaren.
Das bedeutet: Spätestens in 2025 ist die Steinkohle weg, trotz Atomabschaltung, es sei denn, jemand senkt vorher den Anteil der Braunkohle ein, damit noch etwas für die Steinkohle übrig bleibt.
Man kann von Wind- und Sonnenenergie halten was man will, aber seitdem diese auch ohne EEG-Förderung funktionieren, gibt es derzeit einfach keinen Grund mehr, dagegen zu sein.
Auch die gesicherte Leistung ist überhaupt kein Problem, denn das kann eine offene Gasturbine genauso wie ein Kohlekraftwerk leisten, nur das die offene Gasturbine deutlich billiger, schneller und besser ist.
Ferner haben wir ja auch schon ca. 29 GW an Gaskraftwerken und bräuchten nur zusätzliche 10 GW an Gasturbinen.
Der Gasverbrauch würde dadurch nicht einmal ansteigen, denn wir brauchen zwar in der Spitze des Winters ca. 10 GW mehr Leistung, aber nur noch halb soviel Energie aus Gas.
Ergo: Die Gaskraftwerke laufen zwar in der Spitze mit bis zu 35% mehr Leistung aber Sie laufen gleichzeitig nur noch an halb so vielen Stunden wie bisher.
Wenn ich Ihrer Argumentation folge, so kann man das folgendermaßen subsummieren:
Jetzt, wo die Subventionen auslaufen, baut man Windkraftanlagen mit gleichmäßigerer, aber weniger Spitzenleistung. Ferner lohnen sich Gaskraftwerke für Zeiten, in denen Wind und Sonne nicht genügend Energie liefern.
Vorher, als die Subventionen mit der Gießkanne verteilt wurden, hat man kleine Anlagen mit hoher Spitzenlast (wenn sie niemand braucht, dafür fetter Einspeisevergütung) gebaut und aufgrund des dadurch erzeugten künstlichen Preisdrucks die Gaskraft, die für die Energiewende benötigt worden wäre, zunächst abgewürgt.
Die Subventionen haben zum gegenteiligen Effekt geführt, lässt man einfach den Markt machen kommt das gewünschte Ergebnis von allein.
Das heißt, die ganze staatliche verordnete Energiewende war unnötig wie ein Kropf, hat nur Milliarden vernichtet und zum höchsten Strompreis in Europa geführt.
Hätte man von Anfang an den Markt machen lassen, wäre das Ergebnis das Gleiche, der Weg dahin aber ein schonenderer.
Lieber Herr MacLaren,
ich bin begeistert!
Sie haben meinen Text nicht nur aufmerksam gelesen, sondern sogar verstanden.
Ja, sie haben in allem recht, bis auf einen Punkt:
Ohne die Förderung wäre diese Industrie, die heute sämtliche Brennstoffe ersetzen wird, nie entstanden.
Ob man allerdings so üppig hätte fördern müssen, wie man es besonders seit 2011 getan hat, insbesondere für die Solarenergie, das steht allerdings auf einem anderen Blatt.
Wie auch immer: Jetzt, wo Erneuerbare Energie aber kaum noch Förderung kostet, sollten wir in der Tat alles weitere nur noch dem Markt überlassen.
Aber im Ernst, jede Kommission, die konkret Stromerzeuger, kWh und Datum für jeden Vorschlag klar benennt, würde sofort die Energiewende in’s Nichts erkennen, wie es Hans-Werner Sinn nennt.
Prof. Sinn ist Ökonom.
Bzgl. der Energiewirtschaft ist er leider ein Schwätzer, der die Wirkung von disruptivem technischen Fortschritt nicht begriffen hat.
Deshalb finden auch alle Innovationen ohne ihn statt.
Grüne sind wie Tauben, das einzige was sie hinterlassen sind weiße Flecken.
Dabei sind gerade in der Lausitz diese Anti-Kohle NGOs in der Minderheit, insbesondere und gerade in der Gegend um den Tagebau Welzow/ Oberlausitz. Doch die Netzwerke vibrieren derzeit wieder, weil ein „Kohlelobbyist“, gemeint ist Matthias Platzeck (SPD), die Kommission leite und man dagegen vorgehen müsse, so das linke Netzwerk Campact. Einzig Grüne Funktionäre wären gerade so akzeptiert.
In deren Lesart ist jeder, der in der Kommission Zweifel an der Stilllegung hat, ein Feind, der bekämpft werden muss. Das einfache Denken in Dichotomien, das man immer so gerne Rechtspopulisten vorhält. Ein Grüner Kreistagesabgeordneter aus OSL sagte mir vor einiger Zeit, sein Problem wäre, die Grünen Funktionäre verachten im Prinzip die Menschen vor Ort , weil die nicht das richtige linksgrüne Bewusstsein zeigen. Und sein Problem sei, die Menschen vor Ort spüren das. Eben Schwarmintelligenz.
Hinzu kommt, dass die Einwanderung über Asyl- und Fluchtgründe die Bevölkerung weiter ansteigen lässt und entsprechend mehr Energie erforderlich ist. Denn diese Menschen wollen auch in warmen Wohnungen leben, am Abend das Licht einschalten, Autos oder Bahnen nutzen, die Infrastruktur als Ganzes in Anspruch nehmen. Dem Umweltschutz ist das nicht dienlich.
Könnte man nicht über die sozialen Medien fordern, dass alle Kommissionsmitglieder für ihre Stimmberechtigung den Nachweis erbringen müssen, dass sie mindestens die Mathematik-Kenntnisse der mittleren Reife ( Dreisatz auch unter den erschwerenden Bedingungen des Erkennens der Problemstellung in Textaufgaben) sowie auf dem Grundkurs-Niveau bei Physik ( Erhaltungssätze und Folgerungen, Elektrotechnik)und Chemie (Oxidation/Reduktion, Spannungsreihe der Elemente und Folgerungen) mitreden können?
Und in diesem Zusammenhang empfehle ich das Buch Dunkelflaute dieses Autors, das sachkundig und überdies launig-unterhaltsam geschrieben ist.
Ich stimme nicht hundertprozentig mit Herrn Henning überein, aber 90 Prozent sind ja auch eine gute Marge, oder?