Die Schule 4.0 soll nach Vorschlägen der Roland-Berger-Stiftung ohne Sitzenbleiben auskommen. Da hat man allerdings nur eine Seite der Medaille bedacht. Das Sitzenbleiben ist nicht nur für die, die es betrifft, von Bedeutung. Die Gefahr des Sitzenbleibens ist ein Abbild des richtigen Lebens, auf das die Schule vorbereiten muss.
„Also lautet ein Beschluß, / Daß der Mensch was lernen muß. / Nicht allein das Abc / Bringt den Menschen in die Höh’; / Nicht allein in Schreiben, Lesen / Übt sich ein vernünftig Wesen; / Nicht allein in Rechnungssachen / Soll der Mensch sich Mühe machen, / Sondern auch der Weisheit Lehren / Muß man mit Vergnügen hören. / Daß das mit Verstand geschah, / War Herr Lehrer Lämpel da.“
Mit seiner Einleitung des vierten Streichs der Buben „Max und Moritz“ hat Wilhelm Busch unsere heute noch auf breiter gesellschaftlicher Basis ruhende Vorstellung von nicht nur Bildung, sondern auch Schulpflicht sehr fein auf den Punkt gebracht. Kindheit und Jugend sind nämlich unwiderruflich prägend für die Sozialisierung in einem Gemeinwesen. Und „daß das mit Verstand“ geschieht, sprich die staatstragenden Prinzipien einer freiheitlich demokratischen Grundordnung dabei gelten, lässt sich auch in einem freien Gemeinwesen die Pflicht zum Schulbesuch rechtfertigen. In den öffentlichen Schulen bekommen die Heranwachsenden den Stallgeruch der eigenen Herde (in Zeiten der zunehmenden Individualisierung von Freizeitwelten, dem Zerfall von nachhaltigen Familien- und Gemeindestrukturen und nach der Abschaffung der Wehrpflicht vielleicht der letzte Ort dafür). Neben Bildung wird in der Schule kulturelle Identität gestiftet.

Legastheniker: Opfer ideologischer Bildungspolitik
Wenn nun in diesem Sinne Schulpflicht durchaus auch als eine Verpflichtung des Gemeinwesens gegenüber dem Schüler verstanden werden muss, kann es doch nicht einfach Bespaßung durch den Staatszirkus bedeuten. Schule geht über die bloße Berieselung im öffentlichen Unterrichtsangebot hinaus. Neben der demokratischen Identitätsstiftung ist Schule nämlich außerdem der Ausdruck unseres gemeinschaftlichen Willens die Heranwachsenden und ihre Familien institutionell zu fördern, dass sie zum eigenverantwortlichen Leben und zum eigenständigen Broterwerb befähigt werden. Ein solcher Wille entstammt nicht sozialromantischem Gutmenschentum, sondern der schlichten Einsicht, dass ein Gemeinwesen umso mehr gedeihlich fortbestehen wird, umso mehr seine Teilhaber arbeits- und verantwortungsfähig sind. In diesem Sinne ist die Eigenverantwortlichkeit die grundlegende Konvention einer freien Gesellschaft.
Die Schulpflicht verlangt also nicht nur Anwesenheit, sondern wenigstens Bemühen. Bemühen ist die unterste Stufe der Herausforderung, das kann und muss jedem abverlangt werden. – Es wird ja eh schon genug Gehätschel betrieben und vorauseilend vor der Lernverweigerung kapituliert. Vereinfachte und bebilderte klassische Texte als Lektüre, Schreiben nach Gehör und die Inflation der anerkannten Lese-/Rechtschreib-Schwächen oder die Forderung von Elternverbänden zum Beispiel nach der Abschaffung eines verpflichtenden Mathe-Abiturs – weil das so schwer ist – zeugen davon.
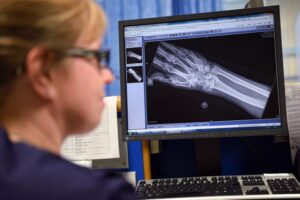
Altersbestimmung: „Eingriff in das Menschenwohl“ und „zu teuer“
Die anschwellende Flut von gerichtlichen Klagen gegen Zensuren zeigt die Spitze des Eisberges, wie häufig inzwischen die Lehrer- anstatt der Schülerleistung für den Lernerfolg verantwortlich gemacht wird. Allerorts wird von Eltern die Verfügbarkeit des real existierenden Nürnberger Trichters vermutet, der bloß von den unfähigen Lehrern aus Böswilligkeit gegenüber dem Kinde nicht zum Einsatz kommt (am Rande: ein Biotop, in dem dann tatsächlich unfähige Lehrer wunderbar, weil schwierig von den Engagierten unterscheidbar, gedeihen).
Inzwischen ist im voranschreitenden Aufweichen der schulischen Verpflichtetheit auch das Ende des Sitzenbleibens allerorts auf die Tagesordnung gekommen. Hamburg und Berlin haben es schon abgeschafft. Andere experimentieren, überlegen und planen schon länger. Und nun spricht dem also auch die Roland-Berger-Stiftung in ihrer Studie „Schule 4.0: Bildungsgerechtigkeit als Basis für sozialen Frieden, Wachstum und Wohlstand“ das Wort. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat den dahinterstehenden Grundgedanken schon 2013 wunderbar auf den Punkt gebracht: „Die Schule muss sich nach den Kindern richten, nicht die Kinder nach der Schule.“
In diesem Sinne können wir dann gleich Zeugnisse, Noten und Abschlüsse abschaffen. Welches Kind mag schon Zensuren und Prüfungen. Bei derzeit 7,5 Millionen funktionaler Analphabeten in Deutschland und weiteren 13,3 Millionen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, die Deutsch allenfalls auf Grundschulniveau beherrschen, wäre auch das Fach Deutsch zumindest an weiterführenden Schulen längst hinfällig. Fragt man die rund sechs Prozent der Schüler, die nach wie vor jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen, könnten wir wohl den Schulschmarr’n gleich ganz bleiben lassen.
Allein man sieht die Schulen in der Pflicht, Verantwortung für die Schüler zu übernehmen. Einmal abgesehen davon, was die denn bisher anderes gemacht haben, klingt das sehr danach, dass die Lehrer den Kindern die Weisheit mit Löffeln einflößen sollten. Aber selbst wenn das ginge, müssten die Kinder wenigstens noch selber den Mund aufmachen und schlucken. In einer demokratischen Gesellschaft lässt sich per se die persönliche Verantwortung nicht gänzlich an gemeinschaftliche Institutionen delegieren. Die Demokratie bedarf des Willens aller – und damit auch der Schüler und Eltern – Verantwortung für sich und für einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Beitrag zum Gemeinwesen zu tragen. „Die soziale Marktwirtschaft kann nicht gedeihen, wenn die ihr zugrunde liegende geistige Haltung, d. h. also die Bereitschaft, für das eigene Schicksal Verantwortung zu tragen, und aus dem Streben nach Leistungssteigerung an einem ehrlichen freien Wettbewerb teilzunehmen, durch vermeintliche soziale Maßnahmen auf benachbarten Gebieten zum Absterben verurteilt wird“, schrieb Ludwig Erhard in „Wohlstand für alle“ 1957. Freiheit und Wohlstand sind nicht trennbar von der Verantwortung des Einzelnen dafür. Freiheit und Wohlstand verpflichten zur Eigenverantwortung.Das Sitzenbleiben darf man dementsprechend als Mahnung des Gemeinwesens an den Einzelnen verstehen. Sitzenbleiben drückt aus, dass die Mindestanforderungen an die gesellschaftliche Teilhabefähigkeit eines Gesellschafters nicht erfüllt sind. Gewiss keine Sanktionskeule, zumal man es eh mit vielfachen Angeboten der Intensivierung und Förderung zu vermeiden sucht und die Ehrenrunde ja ohnehin eigentlich keine Strafe, sondern die Chance, Versäumtes nachzuholen, ist – die man dann freilich auch wahrnehmen wollen muss. Die Möglichkeit des Sitzenbleibens ist die im Heranwachsen unerlässliche Lehre, dass jedes Zusammenleben nicht nur Rechte, sondern immer auch Pflichten beinhaltet. Dass es im wirklichen Leben Grenzen gibt, jenseits derer nicht mehr diskutiert wird, sondern Konsequenzen folgen.

Kündigt der Staat sein Versprechen auf Sicherheit?
Wenn jemand an solchen Forderungen scheitert, dann verlangt das nach unserer Solidarität und genauso nach dem besten Überlegen über prophylaktische Verbesserungsmöglichkeiten. Deswegen die Forderungen zu senken, würde aber eine Abwärtsspirale ingangsetzen.
„Aber das bedenke stets: / Wie man’s treibt, mein Kind, so geht’s.“



Neulich habe ich einmal alles folgendermaßen auf den Punkt gebracht vorgefunden:
„Welche zwei Worte würde ein Linker nie in den Mund nehmen?“ Diese: „Selbst schuld“!
Und da Ursache, aber auch Chance des Sitzenbleibens damit primär verknüpft ist, darf Sitzenbleiben einem Linken niemals als Möglichkeit auch nur spurenweise in den Sinn kommen.
Was bedeutet: Schule (ebenso wie auch Medien, Politik, Gerichte, …) werden erst dann wieder zum Wohle aller arbeiten können, wenn es gelungen ist, das alleszerstörerische Linke Denken dort herauszuholen.
Scheitert das: Willkommen, Deutschland, im Kreise der Drittweltländer.
Ich kann dem Artikel nicht in allem zustimmen. In Norwegen bekommen die Schüler sieben Jahre keine Noten, sind die Norweger deswegen dümmer als Deutsche ?
Zudem habe ich durch mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg mit 40 Jahren einwenig besser die Lehrer zu beurteilen gelernt.
Die Frechheiten als Antworten nach einer Frage zu einer mathematischen Formel waren unglaublich. Anstatt einer Erklärung bekam ich zu hören, ich sollte sie gefälligst auswendig lernen, sie käme in der Abiturklausur vor. In der Abiklausur wurde dann eine Aufgabe mit dieser Formel von Arnsberg als Prüfungsaufgabe abgelehnt, weil es Stoff für das Mathematikstudium im 3. Semester sei.
Ich hatte mich mit Begeisterung und Freude am Lernen am Abendgymnasium angemeldet und war entsetzt, was ich da zu sehen bekam.
Mein Sohn und andere Jungen in der Grundschule hatten unter einer Lehrerin zu leiden, weil diese Frau mit ihren pupertierenden Söhnen nicht klar kam und ihren Hass auf Jungen dermaßen in die Schule getragen hat, daß mehrere Jungen mit Verhaltensstörungen reagierten und einige sogar mit Selbstmord drohten. Erst eine Versetzung in eine andere Klasse mit Hilfe von Schulpsychologen machte dem Spuk ein Ende.
Das wichtigste, was meiner Meinung nach an den Schulen fehlt, ist eine Lehre, bei denen Kinder lernen wie man effektiev lernt und bei der die Freude am Lernen gefördert wird.
Kinder sind nach meiner Erfahrung sehr wißbegierig, aber die Freude am Lernen wird ihnen an vielen Schulen und durch einige Lehrer sehr schnell ausgetrieben.
Und neuerdings scheint ein flächendeckender Islamunterricht , wie die CSU in Bayern es nun fordert, wichtiger zu sein, als Lerninhalte, die im Leben wirklich was bringen.
Es ist unglaublich, was an deutschen Schulen so abgeht und von der Politik auch noch gefördert wird.
Es gibt eben wie in jedem Beruf Profis und solche, die sich als Profis ausgeben. Ich habe selber vor ca. 40 Jahren das Abitur an einem Abendgymnasium absolviert und kann Ihre Bewertung nicht teilen. Sie ist zu pauschalierend. Übrigens gab es zu dieser Zeit für das NRW-Abitur, wenn ich mich recht erinnere, einen Bonus von 0,1 auf den ZVS-Schnitt.
Lieber Herr Maas,
das kann aber nur in einer „idealen“ Schule funktionieren. Das sehe ich aber nicht so. Ich sehe Gesinnungsnoten (EPO) die mehr Einfluss auf eine Zensur haben als Arbeiten.
Bei uns wurden Kuchen für Flüchtlinge gebacken. In kat. Religion werden Synagogen besucht statt die Bibel gelesen. Wir haben Streitschlichter, aber keine richtige Turnhalle.
In Deutsch wurde die Hexenverfolgung thematisiert und Grüfte besucht, in kat. Religion wurde mehr über den Islam und das Judentum gesprochen als über alles andere.
Als Extra dann Sexualkunde in der 3. und 6. Klasse. Das Ganze begleitet von der amerikanischen Abtreibungsagentur „ProFamilia“.
Das römische Imperium und die Griechen wurden in einer Woche behandelt. Viele Aufgaben sind Gruppenaufgaben, statt den Einzelnen zu würdigen. Ich kann dieses „jeder nach seinem Tempo“ einfach nicht vergessen und dieses Schreiben nach Gehör und all diesen Unsinn.
So wird das nichts mit Verantwortung. Die Schulverantwortung müssen wir mittlerweile selbst übernehmen, weil der Stoff nicht vermittelt wird, oder so schlecht, das alles noch einmal wiederholt und vertieft werden muss.
Auch habe ich sehr starke Bauchschmerzen, wenn eine staatliche Instanz und deren Lohnabhängige meine Kinder sozialisieren sollen.
Nein Schule ist nicht zum Sozialisieren da, sondern um etwas zu lernen. Lernen heisst Wissen erwerben. All die anderen Geschenke dürfen Sie gerne behalten. Zusammen mit den Kuchen, der nicht stattfindenden Weihnachtsfeier und wöchentlichen Klassen „Gesprächen“ zur besseren Erziehung zum Denunziantentum.
Viele Grüsse,
Stephan H.
Eigentlich ist die Sache genau geregelt, s. VOGSV Hessen:
§ 1 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler
(2) Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht zur Teilnahme und aktiven Mitarbeit in Schule und Unterricht sowie die Pflicht, durch ihr Verhalten den Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule verwirklichen zu helfen.
Ich persoenlich setze dies um und werde dafuer (von den Schulern) respektiert, auch von denen, die durch das Raster fallen. Gibt es Widerstaende, sind dies immer Helikoptereltern, die nicht akzeptieren, dass ich mit ihren Kindern die Vereinbarung zur Uebernahme der Eigenverantwortung getroffen hatte, die die Eltern per Unterschrift zur Kenntnis genommen hatten.
Es gibt doch nichts das es nicht gibt. VOGSV Hessen. Mein Güte. Da fällt mir nichts mehr ein. Sie erleben mich sprachlos.
Was sind Helikoptereltern? Mitwirkungspflicht bei der Erziehung zum guten Untertanen? Was rinken und rauchen diese Typen? Kling für mich nach kranken Allmachtsphantasien.
Das möchte ich mal sehen, in FFm Gallus oder Gutleut, wenn da jemand bei Ali und Aische mit so einem Wisch und dem Unsinn auftaucht.
Und ich dachte Schreiben lernen nach Gehör ist absurd, aber das? Ich zitiere da nur Rainhard Mey „Meine Söhne geb ich nicht“.
Viele Grüße,
Helikoptereltern:
Ich kenne drei Varianten
1. Versorgungshubschrauber
Mamma, ich hab mein Pausenbrot verges….. ICH KOMME
2. Notfallhubschrauber
Mamma, es reg… ICH KOMME
3. Mamma, ich hab ne 5….. NAAA, DAS WOLLN WIR JA MAL SEHEN
Abends dann im Kegelklub: und dem hab ich nen Brief geschrieben – das hat gekachelt…..
Nr.3 ist der Kampfhubschrauber
Lieber Stephan H.,
natürlich ist Schule zum Lernen da – das war wohl in meinem Beitrag auch nicht misszuverstehen, oder? Aber dabei findet unweigerlich auch Sozialisierung statt und darum geht es mir – nicht dass die Schulfächer mehr auf Sozialisierung als auf zukunftsträchtiges Wissen ausgerichtet sein sollen. Das System Schule sozialisiert unvermeidlich und das sollten wir in der Schulpolitik im Auge haben.
Beste Grüße Gerd Maas
Bester Herr Maas,
wie schön wäre es, wenn Schule die Teilhaber des Gemeinwesens arbeits- und verantwortungsfähig machte. Die Realität sieht auch ohne Verbot von Sitzenbleiben selbst in guten Gegenden so aus: Schrift, Rechtschreibung, Rechnen wird in der Schule, Klasse 1-7 so vernachlässigt, dass die Eltern aktiv gegensteuern müssen. Gleichzeitig werden verdeckt die Kopfnoten wieder eingeführt: Die Unterstellung ist: Wer unruhig ist, kann ja nicht aufpassen – Ergebnis: Bei guten mündlichen Beiträgen und guten schriftlichen Noten kommt ein befriedigend bis ausreichend raus. Ein unbestimmter Anteil jeder Note (selbst Sport) ist „Betragen“.
Gänzlich irrsinnig wird es auf der weiterführenden Schule, wenn Wahlpflichtfächer auszuwählen sind. Zwar ist es möglich in jedem Block etwas Schöngeistiges zu wählen. Aber Informatik und gleichzeitig eine dritte Fremdsprache ist nicht möglich.
Als verantwortungsvolle Eltern bekommt man das schon irgendwie ausgebügelt. Wirklich schauderhaft ist jedoch, was das für die Kinder weniger gebildeter Eltern bedeutet: Die werden trotz eines Abiturzeugnisses kaum aufsteigen können.
Es ist wahrhaftig eine Tragödie! Auch ohne die Roladn Berger Stiftung.
Das mit den Kopfnoten kann ich im Rahmen meines (bayerischen) Horizontes nicht bestätigen, aber ich hab hier auch nur eine handvoll Schulen, mit denen ich öfter zu tun habe und das ist freilich nicht repräsentativ. Als Dozent für VWL an einer Hochschule kann ich allerdings ein Lied von den Rechtschreibfähigkeiten von Abiturienten singen: Da liegt einiges im Argen und da haben Sie natürlich vollkommen recht, dass das langfristig ganz beträchtlich die Chancen mindert. Ein erster Schritt zu mehr Arbeits- und Verantwortungsfähigkeit wäre also wieder mehr Leistungsorientierung. Tatsächlich treiben aber viele Kräfte die Kultuspolitik genau in die andere Richtung. Da finde ich es schon ärgerlich, dass just die Roland-Berger-Stiftung mit einer nicht sehr weit gedachten Analyse auch noch in dieses Segel bläst.
Es gibt tatsächlich einen (kleineren) Teil von Schülern, die aus eigenem Antrieb (intrinsisch) lernen; der weitaus grössere Anteil bedarf allerdings eines mehr oder minder deutlichen Hinweises, dass es ohne gezeigte Leistung auch nicht das gewünschte Zertifikat gibt, wie auch immer Unterricht mit oder ohne Berger organisiert ist. Letztendlich wird, wenn man mit Schülern im Nachhinein spricht, denjenigen Lehrern mit Hochachtung begegnet, die Kurs gehalten haben. Leider tut die etablierte Politik alles, um im Lande eine „panem et circenses“ Mentalität (Hartz 4 und Dokusoaps) zu etablieren. Achtung Ironie!
M. E. soll durch die Forderung nach der generellen Abschaffung des Sitzenbleibens das gegenwärtige Grundübel unseres Bildungswesens kaschiert werden. Dieses besteht darin, dass trotz abgesenkter Leistungsanforderungen und des ständigen nach unten Angleichens der Versetzungsbestimmungen die Anzahl der Sitzenbleiber tendenziell steigend ist. Die Ursachen hierfür sind vielgestaltig – hier u-. a. Elternhaus, soziales Milieu, Schule als ständiges Experimentierfeld, fehlende Kontinuität im Bildungsprozess –, werden jedoch hinter Worthülsen, wie „der Stoff ist zu schwer“, „psychische Störung“, „kompetenzorientiertes Lernen „ und dgl. versteckt.
Lernen macht Mühe, erfordert Ausdauer, Anstrengung, Selbstüberwindung, ständiges Üben. Die Erfolge und Misserfolge des Lernens spiegeln sich bspw. in der Zensur und Beurteilung, aber auch in der Versetzungsentscheidung wider. Zensuren und die Versetzungsentscheidung sind Maßstäbe der Leistungsmessung. Wer die Abschaffung von Zensuren und des Sitzenbleibens fordert, geht von der irrigen Vorstellung aus, dass alle Schüler per se um Bestleistungen bestrebt sind und die nötigen Anstrengungen aus eigenem Antrieb unternehmen. Außer Acht gelassen wird dabei aber, dass der Mensch „aus krummem Holz geschnitzt ist“ (Kant) und es insbesondere bei Heranwachsenden eines ständigen Antriebes (Leistungsdruck) zum Handeln (Leistungserbringung) bedarf. Schule im eigentlichen Sinne ist keine Institution der Spaßgesellschaft, sondern eine Einrichtung, die es dem Einzelnen unter Anleitung/Führung von geschultem Personal und durch ein Höchstmaß eigener Anstrengungen ermöglichen soll, seine individuellen Anlagen/Potentiale zu erkennen und auszuschöpfen.
Die Entscheidung zum „Sitzenlassen eines Schülers“ i. S. d. Einräumung einer nochmaligen Chance sollte daher von den verantwortlichen Lehrkräften immer mit Augenmaß und erst nach Ausschöpfung aller anderen pädagogischen Maßnahmen (individuelle Förderung, Nachhilfe) erfolgen. In einer Reihe von Bundesländern besteht heute schon in Ausnahmefällen die Möglichkeit, Schüler ohne Versetzung in die nächst höhere Klassenstufe zu überweisen. Aus meiner eigenen pädagogischen Praxis kann ich bestätigen, dass die Entwicklung von Schülern, die in einem anderen Klassenkollektiv und mit einer anderen Fachlehrerbesetzung eine „Ehrenrunde drehen durften“ oder aber in der eigenen Klasse ohne Versetzung ein weiteres Jahr lernen konnten, positiv beeinflusst wurde.
Daß es wirkungslos ist, sitzenzubleiben, kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Ich durfte zu meiner Zeit auch eine Ehrenrunde drehen, und ich habe davon profitiert.
Aus heutiger Sicht würde ich das sogar empfehlen. Es kann ein heilsamer Schock sein für einen Schüler, der sich bisher nicht viel um seine schulische Leistung geschert hat. Denn: er verliert sein Umfeld dabei. Die Klassenkameraden, die Clique, die engsten Freunde. Denn die werden sich vielleicht noch mit ihm auf dem Schulhof treffen können, aber nicht mehr im Unterricht. Auch schulisch werden sie ihm enteilen, da sie ihm am Ende doch 1 Jahr voraus sind. Und gerade, wenn das bisherige Umfeld zum schulischen Misserfolg beigetragen hat, weil man sich einig war, nichts für die Schule zu tun, die anderen aber besser damit klarkamen, ist es sinnvoll. Sofern der Ehrenrundler sich in der neuen Klasse nicht gleich wieder an die leistungsresistente Gruppe anschließt.
Um das Sitzenbleiben werden ideologische Grabenkämpfe geführt. Tatsächlich wirkt Sitzenbleiben bei den Einen, bei den Anderen nicht. Die Argumentation gegen das Sitzenbleiben wird aber ausschließlich von den Anderen her geführt.
Sitzenbleiben ist eine neue Chance. Es gibt keinen Mechanismus, wie ihn linke (materialistische!) Bildungspolitiker gern hätten. Ob man die Chance ergreift oder nicht, liegt allein an dem Betroffenen. Denen aber, die eine 2. Chance ergreifen, die also, bei denen es „wirkt“ dürfen nicht betrogen werden. Deswegen muß das Sitzenbleiben erhalten bleiben. Die Alternative wäre ohnehin nur ein weiteres Absenken des Niveaus. Damit ist niemandem gedient.
PS. Mich hat zum Beispiel schon die bloße Möglichkeit des Sitzenbleibens hoch motiviert. Meine Versetzungszeugnisse waren meist um Längen besser als die Halbjahrszeugnisse. In der Mittelstufe galt oft als einzige Motivation: bloß nicht sitzenbleiben! Das funktionierte und hätte es ohne diese Möglichkeit des Scheiterns wohl nicht.
Wem hilft das Sitzenbleiben: Den Coolen oder den gemobbten, die was in der Birne haben und/oder das falsche Schüler- oder Lehrerumfeld, sowie Elternprobleme zuhause.
Die Elternprobleme bleiben in der gleichen Klasse. Beim Sitzenbleiben mit neuem sozialen Umfeld ist alles andere eine Chance. Es geht eben um den Überbegriff Lernen.
Bei der heutigen Zusammensetzung von „Klassen“ auch mit großen Anteilen Lernunwilliger aus anderen Ländern und Kulturen kann ein Sitzenbleiben eine Chance für eine neue „Klasse“ sein.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen dies.
PS. Doch, noch eins. Wenig lerneifrige Schüler streben teilweise ein Sitzenbleiben an, um die schulischen Anforderungen zu verringern. Hintergrund ist häufig, dass sie neben der Schule Geld verdienen, wollen, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen. So meine Erfahrung auf einem technischen Gymnasium.