Dass Norbert Bolz zu den Autoren mit hochpräziser Wahrnehmung unserer Gegenwart gehört, demonstrierte er schon mit seinem Satz, Wokeness sei die erste Bewegung der Menschheitsgeschichte, „die gleichzeitig gegen das Lust- und das Realitätsprinzip kämpft“. Wer in fünfzig Jahren noch wissen möchte, was einmal den Kern dieser merkwürdigen Erscheinung des frühen 21. Jahrhunderts ausmachte, lernt aus dieser kurzen Bemerkung wahrscheinlich schon sehr viel mehr als aus allen hinterlassenen Schriften der Erwachten.
Bolz, Medienwissenschaftler, Philosoph, Autor, befasste sich aber nie nur mit dem Augenblick. Er schaut stets zurück, vor allem interessiert ihn aber, was als nächstes kommt. „Zurück zur Normalität. Mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand“ fasst zwar das Wesen der westlichen Kulturrevolutionäre noch einmal zusammen, gewissermaßen als Resümee. Denn die Ideologie befindet sich unübersehbar in ihrer fortgeschrittenen Niedergangsphase. Ihn beschäftigen folglich die beiden Fragen: wie endet die Bewegung, die gut zehn Jahre lang die sinnproduzierenden Institutionen fast aller westlicher Länder mehr oder weniger fest im Griff hielt? Und wie geht es danach weiter? Wie kommt die Gesellschaft also aus dem von einer kleinen Funktionselite erzeugten Ausnahmezustand heraus?
Schon der Umstand, dass ein Intellektueller ein Buch über diesen nötigen Rückmarsch vorlegt, zeigt, dass es sich bei dem, was er empfiehlt – Normalzustand, Augenmaß, Vernunft – immer noch um einigermaßen exotische Größen handelt. Niedergang des Irrationalen heißt schließlich nicht, dass es schon erledigt wäre. „Die Wokeness stellt das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf. Der Alarmismus stellt das Verhältnis von normal und extrem auf den Kopf“, heißt es zu Beginn. Und er findet in seinen Pointenstil auch eine griffige Definition des Gegenpols: „Normalität ist wie Gesundheit – man bemerkt sie nicht, wenn sie statt hat.“ Natürlich bietet er einen deutlich komplexeren Normalitätsbegriff an, der sich aber in der Feststellung verdichtet: Normalität ist das, was viele erstreben und erhalten wollen, weil sie den Rückgriff auf das Bewährte bedeutet. Und in den Kreis des Bewährten gelangen Formen, Gebräuche und Normen nie grundlos.
In „Zurück zur Normalität“ geht es um zwei Mächte, die das Gebräuchliche und Alltägliche bedrängen: Zum einen den Wokismus mit seiner Hypermoralität, zum anderen den Daueralarmismus, der mit dem Weltuntergang droht – derzeit wegen der Klimaerwärmung, morgen könnte aber auch ein anderer Topos an deren Stelle treten. Beide laufen an einer Stelle zusammen; die Schlussfolgerung lautet, die alte westlich-weiße Gesellschaft als Ursache aller Übel hätte zu verschwinden. Anders gebe es keine Erlösung.
In der breiten Bevölkerung fassten beide Drohbotschaften nie ernsthaft Fuß, wohl aber in der Funktionselite: Es gibt …Parallelgesellschaften, die sich bestens integriert und pudelwohl fühlen, obwohl sie längst jeden Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben. Sie leben in den geistigen Ghettos der Parlamente, Redaktionen und Universitäten und diktieren uns von dort aus, wie wir die Welt zu sehen haben.“
Bolz befasst sich nicht nur mit dem Begriff der Normalität, der eben gegen dieses moralgestützte Diktat steht, sondern auch mit der Frage, warum so viele Menschen das Normale schätzen und für sich wünschen, selbst wenn sie mit dem Gegenteil kokettieren. „Das Leben wäre unerträglich, wenn sich das meiste nicht von selbst verstünde und man ständig Entscheidungen treffen müsste. Normal ist, was sich von selbst versteht und nicht erst ausgehandelt werden muss“, lautet sein Urteil. Das heißt: Normalität ist gerade das Unspektakuläre. Worin liegt dann ihre Anziehungskraft?
„Normalität“, so beantwortet Bolz diese Frage, „ist die größte zivilisatorische Errungenschaft. Sie ist der vorzivilisatorischen Welt abgetrotzt und hat die Selbsterhaltung des Menschen auf Dauer gestellt… Die vergessene Vorgeschichte der Normalität ist die Geschichte des Kampfes von Gesetz und Ordnung gegen das Chaos.“ Weil diese Ordnung, zu der Familie, Eigentum und Traditionskenntnis gehören, jahrelang von den Erwachten zum eigentlichen Problem erklärt wurde, muss jetzt, so sein Credo, die Wahrnehmung der Bürger wieder justiert werden, und zwar obwohl die Mehrheit die Glaubenssätze der erwachten Priester nie teilten. Aber deren Verkehrung, Entleerung und beliebige Wiederauffüllung von Begriffen wirkt weit über das tragende Milieu hinaus, und dürften in ihrer Wirkung auch nicht so schnell verschwinden. Für diesen also noch immer anhaltenden Prozess prägt er das schöne Wort „Normalitätsschwund“. Wie lässt sich diese Entwicklung nach Ansicht des Autors umkehren?
Jeder weiß zumindest in der Theorie, was einem in unübersichtlichem Gelände oder auf hoher See weiterhilft, nämlich die Orientierung an Fixpunkten, idealerweise an Fixsternen. Sie helfen erst einmal bei der Bestimmung der eigenen Lage, dann aber auch beim Navigieren. Von diesen festen Marken handelt das Buch von Norbert Bolz im Kern.
Eins seiner Kapitel behandelt „starke und schwache Bindungen“; in die Kategorie ‚schwach‘ fallen etwa Ausrichtungen an einer selbstentworfenen Identität, an virtuellen Bekanntschaften im Internet, an beruflichen, also zweckunterworfenen Netzwerken. Zu den starken Bindungen zählt Bolz Liebe, Ehe, Familie, Freundschaft, also alles, was kleine, aber sehr feste Kreise bildet.
Auf originelle und einleuchtende Weise begründet er, warum diese tradierten Formen nicht nur quer zum woken Glaubensgebäude stehen, sondern auch zur durchrationalisierten Welt, die sich gern den Begriff „disruptiv“ beilegt. „Starke Beziehungen wie das Vater-Sohn-Verhältnis, die Ehe, aber auch die enge Freundschaft bieten nur wenige Möglichkeiten auf wirklich Neues, zum Beispiel unternehmerische Ideen und Innovationen zu stoßen. Deshalb schließen sich Intimität und Effizienz aus.“
Wie der direkte Gegenentwurf zur starken Bindung aussieht, lässt sich in eine Unmenge an Blogs und in Artikeln nachlesen, die sich vor allem an junge Frauen richten, um ihnen zu raten, keine intime Beziehung einzugehen, wenigstens nicht mit Männern, keine Kinder zu bekommen und am besten allein zu bleiben, und zwar mit der Begründung, nur so, frei von jeder Bindung, könnten sie „wachsen“, also ihre Individualität entwickeln. Natürlich auch – eigentlich ist das hauptsächlich gemeint –intensiver der Erwerbsarbeit nachgehen und konsumieren.
In urban-postbürgerlichen Kreisen der USA breitet sich schon seit längerem der Trend der „Self Marriage“ aus, also der zeremoniellen Selbstheirat, die sich durch den ambivalenten Umstand auszeichnet, dass eine Scheidung nicht in Frage kommt. Influencerinnen bei TikTok im mittleren Alter bezeichnen sich als „child free“, kinderfrei, und erklären ihr Leben zum Erfolgsmodell. Falls eine Frau doch in einer Partnerschaft feststeckt, dann sollte sie nach Ansicht dieser Ratgeber am besten ihre „Care-Arbeit“ in Geld umrechnen. Glück, auch diese Wendung gehört zu den Erkenntnissen, die dieses Buch bietet, knüpft sich eben nicht an Unabhängigkeit. „Man müsste eher umgekehrt sagen: Was uns glücklich macht, bindet uns.“
Der Autor prognostiziert folgerichtig die gesellschaftlichen Konsequenzen der Bindungsfreiheitspropaganda, die sich tief in die Demografie ein- und fortschreiben, auch dann noch, wenn diese Propaganda irgendwann auf dem Friedhof der Ideologien landen sollte. Die größten Verteilungskonflikte der Zukunft, meint er, würden „nicht mehr die Sphäre der Produktion, sondern der Reproduktion“ betreffen: „Uns erwartet nicht nur ein erbitterter Kulturkampf zwischen Eltern und Kinderlosen, sondern auch ein harter ökonomischer Verteilungskampf zwischen den Generationen.“
Der demografische Niedergang, das nur nebenher, betrifft fast alle westlich geprägten Länder, allerdings mit einer Ausnahme: Israel. Und das liegt nicht nur am Kinderreichtum der Ultraorthodoxen, auch nicht an der Geburtenrate der 20 Prozent arabischer Israelis. Im Gegenteil, die Zahl der Kinder bei jüdischen Frauen liegt bei 3,06, die der arabischen Frauen bei 2,75. Es scheint also ein Zusammenhang zu bestehen zwischen Familie, Reproduktion und dem Willen, die Identität des eigenen Landes zu erhalten.
Was „Zurück zur Normalität“ so lesenswert macht, ist zum einen die stupende Bildung des Autors, mit der er in die Geschichte des Westens und der Bürgerlichkeit blickt, aber auch der Umstand, dass er seinen Lesern keine Litanei von Verlust und Vergeblichkeit anbietet, sondern das Gegenteil. Er meint, dass es durchaus einen Rückweg zur Vernunft gibt – eben deshalb, weil das, was er als Normalität beschreibt, über tiefe Wurzeln verfügt.
Er wirbt für einen Konservatismus, der die „Tradition der Freiheit“ einschließt, neben vielen anderen selbst gewählten und nicht erzwungenen Traditionen. „Der Konservative, der sich so versteht“, so Bolz, „verteidigt die phantastischen Errungenschaften der Moderne – als da sind: wissenschaftlicher Fortschritt, technische Weltbeherrschung und gesellschaftlicher Wohlstand. In verwirrten Zeiten wie der unseren kann der Konservatismus aber auch das Ausharren auf scheinbar verlorenem Posten sein, das Training der Durchhaltefähigkeit in einer schwer haltbaren Position – etwa mit einer Meinung, mit der man alleinsteht.“
Nur: so allein steht er damit nicht. Der Gezeitenwechsel dringt von den USA langsam nach Westeuropa herüber, wobei sich das offizielle Deutschland wahrscheinlich als hartnäckigste Festung des Wokismus erweist. Wer die „gesellschaftliche Form der Normalität, die Bürgerlichkeit“ nicht als bedrohtes Reservat sehen will, sondern als immer noch als Kraftfeld, wer diese Bürgerlichkeit lustvoll verteidigen und vor allem leben möchte, der findet kaum ein besseres aktuelles Buch.
Dort findet sich auch die listige Bemerkung von Gilbert Keith Chesterton von der „ecstasy of being ordinary“, der Ekstase der Normalität. Gerade heute stellt die Normalität ein echtes Abenteuer dar, das eigentlich Spannende im Vergleich zu den ermüdenden Tiraden gegen alte weiße Männer, den Westen, Ehe und Tradition.
Eigentlich könnten auch die Wokisten und ihr Gefolge „Zurück zur Normalität“ mit Gewinn lesen (was sie trotzdem unterlassen dürften). Denn hier können sie lernen, warum ihr Überzeugungsgebäude schon heute als halbe Ruine dasteht: Was sie verkünden, bindet nichts und niemand in der Tiefe. Ihre Lehren tradieren nichts. Sie tragen nichts zum Glück bei. Sie bilden keine Strukturen aus, die Epochenbrüche überdauern. Um es abgewandelt mit Kleist zu sagen: sie kommen zwar nicht aus dem Nichts, denn es gibt lange geistige Vorläufe. Aber sie gehen ins Nichts.
Norbert Bolz, Zurück zur Normalität. Mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. LMV, Hardcover mit Schutzumschlag, 256 Seiten, 24,00 €.


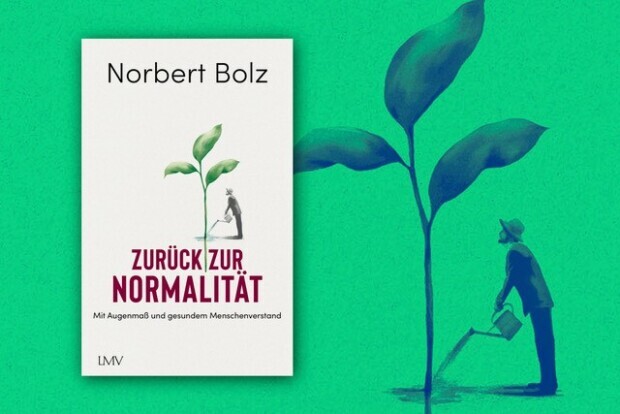
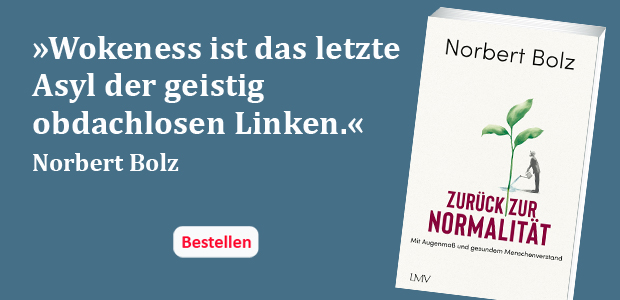
0 Kommentare