Es ist stets das alte Lied: „Denn so ist der Mensch! Ein Glaubenssatz könnte ihm tausendfach widerlegt sein – gesetzt, er hätte ihn nötig, so würde er ihn immer wieder für wahr halten“ (Nietzsche). Und: „Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht ein. Manche Irrtümer halten wir unser Leben hindurch fest, und hüten uns, jemals ihren Grund zu prüfen, bloß aus einer uns selber unbewussten Furcht, die Entdeckung machen zu können, dass wir so lange und so oft das Falsche geglaubt und behauptet haben“ (Schopenhauer).
Nietzsche und Schopenhauer werden erneut Recht behalten, und das gerade auch in einer angeblich ach so modernen, „woken“ Wissensgesellschaft. Aber wurde „Wissensgesellschaft“ nicht zu einem Euphemismus, der verschleiert (verschleiern soll), dass wir auf dem Weg in eine voraufklärerische Zeit sind?
Bemühen wir eine entscheidende Passage aus Immanuel Kants Essay „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ von 1784: „Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.“
[inner_post 1] Kant kannte den Begriff und das Prinzip „postfaktisch“ noch nicht. Aber „postfaktisch“ könnte von ihm stammen. Denn große Teile der real existierenden öffentlichen, ja leider auch „wissenschaftlichen“ Debatte drehen sich nicht um Fakten und um Rationalität, sondern um das, was als „gut“ angesagt ist. Es geht kaum noch um „wahr“ versus „falsch“, sondern um „gut“ versus „nicht gut“.
Wahrscheinlich hätte Kant anstelle von „postfaktisch“ sogar die Begriffe „präfaktisch“ oder „parafaktisch“ geprägt. Denn vieles von dem, was heute politisch und medial „in“ ist, folgt nicht (post) auf die Fakten, sondern geht den Fakten (prä) voraus, um sie von Haus aus ignorieren zu können, um gegen sie immunisiert zu sein. Oder aber das, was angesagt ist, liegt weit neben (para) den Fakten. Paranoid eben, neben die Fakten gerückt; „verrückt“ sagt der Volksmund in seiner unbestechlichen diagnostischen Schärfe.
Der Mensch will es eben auch heute intellektuell einfach haben. Er will Simplifizierungen; Ideologien und Ideologen bieten sie ihm. Der Mensch ist auch kein rationales Wesen, sondern ein rationalisierendes (Leon Festinger). Weil er sich ungern im Zustand kognitiver Dissonanz befindet, ummantelt er sein Bauchgefühl, seine Emotionalität, sein Pathos gerne pseudo-rational (rationalisierend), quasilogisch, also ideologisierend.
Dabei gilt: „Von allen politischen Ideen ist der Wunsch, die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle“, so Karl Popper. In seinem großen Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ beklagt er im 14. Kapitel einen „moralischen Futurismus“, einen „orakelnden Irrationalismus“, mit dem Gefühle und Leidenschaften über Denken und Erfahrung dominierten.
Zu diesem Buch: Die selbsternannten, „woken“ Intellektuellen sind auf das Gute geeicht, anderen, denen das (Nach-)Denken nicht abhandengekommen ist, geht es um Tatsachen. Heinrich Zettler ist so einer. Er schaut sich aus einer reichen Erfahrungsvita als Familienoberhaupt, als Unternehmer, als Naturwissenschaftler sowie als vielseitig gebildeter, polyglotter, historisch und philosophisch belesener Mann die Realitäten an, nicht als Kulturpessimist.
Geleitwort aus: Heinrich Zettler, Denkverbote. Die Diktatur des Postfaktischen. GHV, Hardcover, 492 Seiten, 24,90 €.


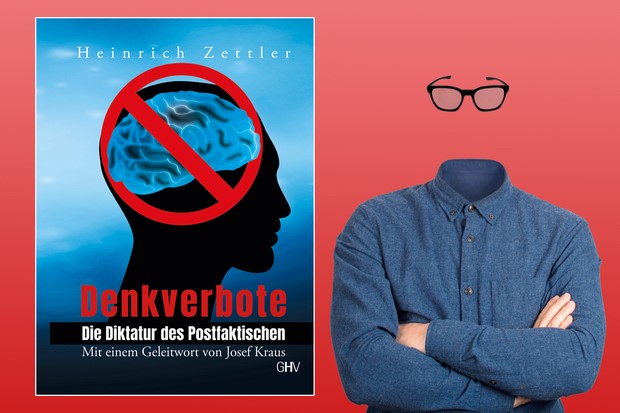
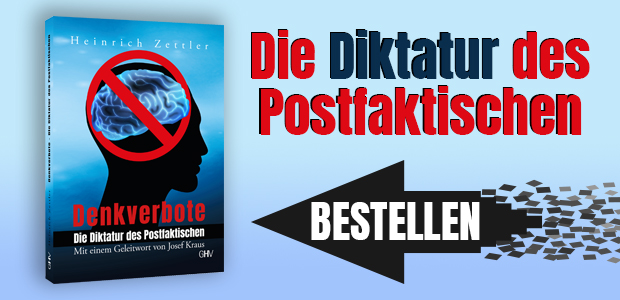





0 Kommentare