Ratzinger war nie nur ein auf den akademischen Betrieb fixierter Theologe. In den Jahren des Konzils verbindet sich seine geistige Unabhängigkeit mit einem Verantwortungsbewusstsein für die Gesamtkirche. Dass er auf den erfahrenen, abgeklärten und gleichwohl mutig nach vorne schreitenden Kardinal Frings traf, war ein Wink des Schicksals. Den jungen Star-Theologen nicht als Berater zu verpflichten, wäre allerdings ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Hätte es Frings nicht getan, würde ihn Kardinal Döpfner oder ein anderer deutscher Bischof zum Konzil berufen haben.
So deutlich mit dem Vatikanum Ratzingers Stärken zutage traten, so unübersehbar waren allerdings auch seine Schwächen. Da war zum einen eine Fehleinschätzung der Folgen, die sich aus der Lust an der Veränderung beziehungsweise der Dekonstruktion der katholischen Kirche ergeben könnten, insbesondere im Bereich der Liturgie. Zum anderen eine Arglosigkeit gegenüber einem Lager, das nicht nur einen interessanten theologischen Ansatz vertrat, wie Ratzinger lange glaubte, sondern einen Systemwechsel anstrebte. Definitiv falsch eingeschätzt wurde die Wirkung jener Kräfte, die aus den Gesetzen der sich entwickelnden Mediengesellschaft entstanden. Niemals zuvor war ein Konzil so stark einer Dynamik ausgesetzt, durch die außenstehende Kräfte das Geschehen zu beeinflussen suchten. Mit weiser Voraussicht hatte Johannes XXIII. bereits im Oktober 1961 davor gewarnt, es wäre »tatsächlich ein Unglück, wenn aus Mangel an hinreichender Information oder aus Mangel an Diskretion und Objektivität ein religiöses Ereignis von solcher Bedeutung eine unzutreffende Darstellung und dadurch eine Entstellung seines Charakters und der wirklichen Ziele erführe«. Deshalb müsse alles dafür getan werden, um »das Konzil in seinem wahren Licht« bekannt zu machen.
[inner_post 1] Hinzu kam ein Phänomen, das der amerikanische Medienwissenschaftler Marshal McLuhan in den Sechzigerjahren mit dem Begriff »the medium is the message« beschrieb. Heißt im Falle des Konzils: Nicht so sehr die Inhalte zählen, sondern das Event als Event und die Interpretation des Events, dessen inhaltliche Aussagen mehr und mehr von Legendenbildung überlagert werden. Diese Überlagerung schafft wiederum eine Realität, die am Ende realer zu sein scheint als das, was auf dem Konzil selbst geschah und in seinen Texten verabschiedet wurde.
Es entsprach dabei der Logik von Medien, die ihre eigene Vorstellung von Kirche und Reform hegten, dass nicht nur das Konzil gedeutet und umgedeutet werden musste, sondern auch etliche seiner Vertreter. Wie es irgendwann zwei Konzile gab – das authentische Konzil der Väter und das virtuelle Konzil der Medien –, sollte es eines Tages auch zwei Ratzinger geben. Einen realen Ratzinger, wie ihn jene kannten, die mit ihm arbeiteten, und einen Ratzinger der Medien. Dass es gelingen konnte, den Berater Frings’ später als einen »Verräter des Konzils« darzustellen, gehört sicherlich zu den skurrilsten Folgen des Vatikanums.
Die Fakten jedenfalls geben die Theorie von der »Wende« eines ehedem progressiven Theologen in einen reaktionären Denker nicht her. »Das wahre Erbe des Konzils liegt in seinen Texten«, wurde Ratzinger nicht müde zu verkünden. »Wenn man die sauber und gründlich auslegt, dann ist man vor den Extremismen nach beiden Richtungen hin bewahrt; und dann öffnet es auch wirklich einen Weg, der noch viel Zukunft vor sich hat.« Wie als Vermächtnis sollte er noch bei seinem letzten Auftritt als Papst, drei Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, in einer frei vorgetragenen Rede appellieren: »Es lohnt sich, immer zum Konzil selbst, zu seiner Tiefe und zu seinen wesentlichen Vorstellungen zurückzukehren.«
Kaum hatten sich die Tore der vierten Session geschlossen, begann für Ratzinger in der Tat eine Herkulesarbeit, ein fünfzigjähriger Kampf um das Erbe des Konzils. Seine Losung hieß: »Klarmachen, was wir wirklich wollen und was wir nicht wollen, das war dann seit 1965 ein Auftrag, den ich empfunden habe.« (…)
[inner_post 2] Das Konzil hatte entgegen aller Vorsätze eine beispiellose innerkirchliche Kulturrevolution in Gang gebracht. »Unter den Seelsorgern und erst recht im christlichen ›Fußvolk‹ breitete sich das Gefühl aus, dass alles, was man über Jesus sagen, hören oder selbst lesen konnte, bestenfalls Halbwahrheiten waren«, so der Theologe und Zeitzeuge Hansjürgen Verweyen. »Es schien sich nur noch die Wahl anzubieten zwischen einem stillschweigend praktizierten Agnostizismus, einem blinden, fundamentalistischen Glauben oder dem Auszug in spirituell attraktivere Formen von Wahrheit und Geborgenheit.« Der Politikwissenschaftler Franz Walter analysierte: »Die Resistenz- und Immunkräfte des Katholizismus gegen die Säkularisation schienen zu versiegen.« Unter den katholischen Gläubigen »machte sich eine wachsende Krisenstimmung breit, Pessimismus, Desorientierung, auch Unmut«. Kardinal Frings hielt in seinen Erinnerungen fest: »Es kam dann freilich eine Zeit der Krise über die Kirche, und manches wurde ›im Geiste des Konzils‹ in die Welt gesetzt, woran die Konzilsväter im Traume nicht gedacht hatten.«
Schon in den Fünfzigerjahren war es zu einem Rückgang von Berufungen, Beichtfrequenzen und Gottesdienstbesuchen gekommen. Zwei Jahre nach Abschluss des Konzils aber rutschte der Anteil der regelmäßigen Kirchgänger unter den Katholiken regelrecht ab. Von 1967 bis 1973 sank er von 55 auf 35 Prozent. Bis 1970 schnellte die Zahl der jährlichen Austritte aus der katholischen Kirche Deutschlands, die konstant bei zirka 25.000 gelegen hatte, auf 70.000 hoch. (…)
Nicht zuletzt sollte auch der Konzilspapst die Diagnosen Ratzingers bestätigen. »Nach dem Konzil hat sich die Kirche eines großartigen Erwachens erfreut und erfreut sich noch immer«, resümierte Paul VI. während der Generalaudienz vom 25. April 1968, »aber die Kirche hat auch gelitten und leidet noch immer an einem Wirbelsturm von Ideen und Tatsachen, die sicher nicht dem guten Geist gemäß sind und die nicht jene gesunde Belebung verheißen, welche das Konzil versprochen und gefördert hat.«
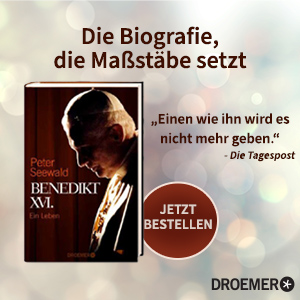 In einer dramatischen Zuspitzung sollte er am 21. Juni 1972 in einer Predigt zum neunten Jahrestag seiner Inthronisation über den »heftigen und vielschichtigen Umsturz« sprechen, den niemand erwartet habe. Was nicht ganz richtig war. Insbesondere italienische Kirchenvertreter hatten beizeiten davor gewarnt, durch die unerwartete Liberalität des Konzils würden Schleusen geöffnet, die besser geschlossen blieben. Dann sprach der Pontifex sein berühmtes Wort vom »Rauch Satans, der durch irgendwelche Ritzen in den Tempel Gottes eingedrungen ist«. Paul VI.: »Der Zweifel ist in unser Bewusstsein eingedrungen, und er ist durch die Fenster eingedrungen, die doch für das Licht offen sein sollten.«
In einer dramatischen Zuspitzung sollte er am 21. Juni 1972 in einer Predigt zum neunten Jahrestag seiner Inthronisation über den »heftigen und vielschichtigen Umsturz« sprechen, den niemand erwartet habe. Was nicht ganz richtig war. Insbesondere italienische Kirchenvertreter hatten beizeiten davor gewarnt, durch die unerwartete Liberalität des Konzils würden Schleusen geöffnet, die besser geschlossen blieben. Dann sprach der Pontifex sein berühmtes Wort vom »Rauch Satans, der durch irgendwelche Ritzen in den Tempel Gottes eingedrungen ist«. Paul VI.: »Der Zweifel ist in unser Bewusstsein eingedrungen, und er ist durch die Fenster eingedrungen, die doch für das Licht offen sein sollten.«
Nach dem Ende des Zweiten Vatikanums erlebten Ratzinger und Mitstreiter wie de Lubac, Frings, Daniélou, Balthasar, Congar und Jedin, dass viele der Reformimpulse nur äußerlich aufgenommen und den Plausibilitäten einer weitgehend säkular gewordenen Gesellschaft angepasst wurden. Aber bald sollten ganz andere Fragen die öffentliche Diskussion beherrschen. Die Begeisterung für das Konzil wurde abgelöst durch eine Begeisterung für die Ideen des Marxismus. Jetzt ging es nicht mehr um Liquidierung muffiger kirchlicher Überlieferungen, sondern um die Liquidierung von Religion und Kirche überhaupt.
Für das Ende dieser Periode zog der Politologe Franz Walter ein erschütterndes Fazit. Über ein Jahrhundert, heißt es darin, »hat der deutsche Katholizismus seine traditionellen Werte und Organisationsstrukturen erfolgreich verteidigt«. Die Katholiken hätten »aufgrund ihrer traditionellen Werte auch die Krisen, die die Moderne produzierte«, weit besser überstanden als andere Teile der Bevölkerung. Der langjährige Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung betonte, die moderne Gesellschaft habe »von diesen gemeinschafts- und identitätsstiftenden, kulturelle Orientierungen vermittelnden Werten durchaus gezehrt«, denn die liberalen Gesellschaften brächten von allein »solche Bindemittel kaum hervor«. Nach den Umwälzungen in den Sechziger- und Siebzigerjahren aber müsse man konstatieren: »Die katholische Lebensart, als jederzeit leicht erkennbare und unterscheidbare Gruppenkultur, existiert als Massenphänomen nicht mehr.« (…)
1968 und die Legende von der Wende
Für viele Medien und Politiker sind die Studenten die »fünfte Kolonne Moskaus«, für manche auch nur ein Mob von Gammlern. »Stoppt den Terror der Jungroten jetzt!«, titelt Bild. Ein Jahr zuvor, am 2. Juni 1967, war in Berlin bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien der 26-jährige Germanistikstudent Benno Ohnesorg ums Leben gekommen. Getötet mit einem Kopfschuss durch den Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras. Erst 2009 erfuhr die Öffentlichkeit von Kurras’ wahrer Identität als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Der Stasi-Mann war zum Kampf gegen den Klassenfeind abkommandiert worden und sollte als »Agent Provocateur« die aufgewühlte Situation in Westberlin eskalieren lassen.
[inner_post 3] Nie zuvor in der deutschen Geschichte war eine Generation materiell so gut versorgt aufgewachsen wie die nach 1945 Geborenen. 1968 stand das Wirtschaftswunder in voller Blüte. Die Arbeitslosigkeit lag bei 0,9 Prozent. Aber beim Aufbegehren der Jugend geht es nicht um Arbeitsplätze. Die Revolte war komplexer, als es in der Nachbereitung ikonografische Bilder mit Hauptdarstellern wie Dutschke und Fritz Teufel oder den späteren RAF-Anführern Andreas Baader und Ulrike Meinhof vermitteln. Im Vordergrund stand der Generationenkonflikt, der Aufstand gegen tradierte Geschlechter- und Erziehungsnormen. Aber es ging 1968 auch um Mode, um schicke Autos, um Sex, um Drugs und Rock ’n ’Roll. Vieles vermischte sich da. Abscheu vor der Spießigkeit der Eltern. Lust an Provokation und Krawall. Suche nach dem Sinn des Lebens. Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Was die Studenten betraf, so »hegten sie einen fast religiösen Glauben«, urteilte 50 Jahre später die Süddeutsche Zeitung, und griff damit eine frühe Diagnose Joseph Ratzingers auf, für die er lange gescholten wurde. Ihr Ziel: »Man könne das Paradies auf Erden erreichen, verbunden mit der Empörung darüber, dass der Kapitalismus das nicht schafft.«

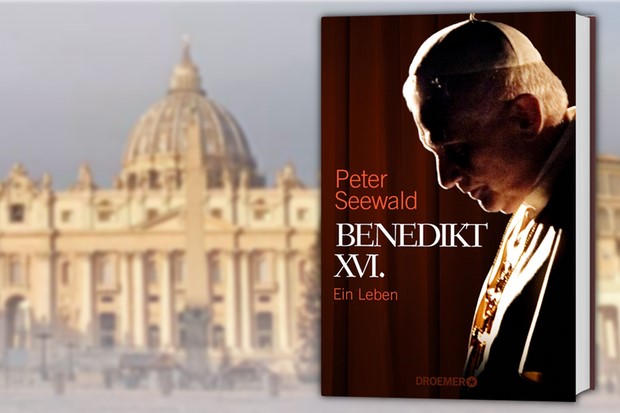





0 Kommentare