Jahrzehntelang hatte ich als typisches Kind einer Demokratie über Probleme der Meinungsfreiheit gar nicht groß nachgedacht, sondern sie den gegenwärtigen Diktaturen in der Welt bzw. längst vergangenen vordemokratischen Regimes (mit ihren Tabus – Einfügung d. Red.) zugeordnet. Die Diskussion über politische Korrektheit hatte mich nie so richtig interessiert. Mit Erheiterung nahm ich die sprachlichen Auswüchse der Frauenbewegung zur Kenntnis und fragte mich, wie lange der »Allmächtige Gott« in der deutschen Sprache noch sein männliches Geschlecht behaupten konnte. Belustigt registrierte ich das Verschwinden von »Negerkuss« und »Mohrenkopf« aus dem Sprachschatz des Konditors und zitierte aus Schillers Fiesco: »Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.« Ich registrierte die verdruckste Dummheit solch sprachlicher Purgierungsversuche, erwehrte mich des Zeitgeistes mit Spott und meinte im Übrigen, dass er mich nicht beträfe. Das war wohl ein Irrtum.
Als ich Deutschland schafft sich ab vorbereitete, Aufsätze und Bücher las, die amtliche deutsche Statistik auswertete oder die UNO-Datenbank für Bevölkerungsprognosen befragte, kam mir in meiner stillen Stube nicht entfernt die Idee, dass ich unmoralische, gar verbotene Fragen aufwerfen könne. Noch Monate nach Erscheinen meines Buches meinte ich, es ginge darum, inhaltliche Fragen zu erläutern, die vielleicht in meinem Buch nicht ausreichend klar dargestellt seien. Darum ging es meinen Kritikern aber gar nicht. Es war die Art meines Blicks auf die Probleme, die bei vielen Hass auslöste. Und dieser Hass wurde offenbar noch dadurch bestärkt, dass meine Analysen im Empirischen wurzelten und die darauf aufbauenden Gedankenketten den herkömmlichen Regeln der Logik folgten. (…)
[inner_post 1] Die im Folgenden analysierte Rezeption von Deutschland schafft sich ab durch einen bestimmten Teil der Medien war dadurch gekennzeichnet, dass sie zumeist gar nicht die Ebene der sachlichen Auseinandersetzung erreichte. (…)
Der Lieblingsphilosoph der Deutschen, Richard David Precht, empörte sich am 26. September 2010 im Spiegel:
»Wieso kann ein hölzerner Finanzfachmann mit seinen Vorurteilen, seinen turmhoch gestapelten Statistiken und seinen biologischen Nachschlagewerken eine solche Aufregung verursachen? Weil er ein Tabu gebrochen hat? Weil er der schweigenden Mehrheit eine näselnde Stimme gibt? Weil den Massenmedien langweilig war? Oder doch: Weil er ins Schwarze traf, als er ins Braune redete?«5
In der taz sprach Hartmut El Kurdi von »Deutschlands beliebteste[m] Quartalsirren Thilo Sarrazin« und seiner »rassistische[n] Zahlenmystik«.6 Hans-Ulrich Jörges vom Stern schäumte noch drei Monate nach Erscheinen des Buches: »Thilo Sarrazin … hat Widerwärtiges freigesetzt« und beklagte »eine Welle der unverhohlenen, schamlosen Stigmatisierung und Ausgrenzung muslimischer Migranten«.7 Dazu passt die Rezension des Buches im Stern: »Es ist lächerlich, wie ein vorgeblicher Mann des Wortes, denn als solcher versteht sich Sarrazin ja,… einen Verlag findet, der solchen Unfug drucken mag.«8
In einer Rezension des Düsseldorfer Philosophieprofessors Gerhard Schurz hieß es dagegen, Sarrazins Buch sei
»ein seriöses Werk. Auf wissenschaftlichem Anspruchsniveau sind zwar gelegentliche vorschnelle Schlussfolgerungen oder unzureichende Absicherungen zu kritisieren, doch kenne ich kaum einen populären Autor, der Breitenwirkung und wissenschaftliche Standards so gut vereint. Sarrazin hat es verdient, ernsthaft diskutiert zu werden.«
Es gehe Sarrazin »um die Verteidigung der Errungenschaften der Aufklärung«, und statt ihn »aus ihrer Partei auszuschließen, sollten sich die SPD-Politiker klarmachen, dass er jene Werte verteidigt, aus denen ihr ureigenes politisches Erbe einst hervorging«.9 Deutschlands bedeutendster Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler sagte, Sarrazins Problemdiagnose treffe »ins Schwarze« und sei »das Reformplädoyer eines geradezu leidenschaftlichen Sozialdemokraten«.10 Der Bonner Soziologe und Psychologe Erich Weede schrieb in einer Rezension:
»Sarrazins Zielsetzung der Erhaltung und Verbesserung des Humankapitalbestandes in Deutschland hat nichts mit ›Rassismus‹, ›Biologismus‹ oder auch nur einer Erbtheorie der Intelligenz zu tun. Selbst seine Befürchtung der absehbaren Verschlechterung der Humankapitalausstattung in Deutschland kommt weitgehend ohne erbtheoretische Annahmen aus.… Massive Zuwanderung vor allem aus dem islamischen Kulturkreis könnte auch mit der politischen Stabilität Deutschlands langfristig unvereinbar sein.«11
[inner_post 2] Man vergleiche die Sprache: In den vier Zitaten des ersten Absatzes treibt kaum gezügelte Wut die sprachliche Polemik. Im zweiten Absatz loben drei Wissenschaftler – ein Philosoph, ein Sozialhistoriker und ein Soziologe – in ruhigen Worten exakt dasselbe Buch. Offenbar waren bei denen, die das Buch ablehnen, starke Emotionen im Spiel, wie sie üblicherweise durch Tabuverletzungen ausgelöst werden.
Gemäßigter war die grundsätzliche Kritik von Gustav Seibt. Er sprach von einem »neuen Konservativismus«, der in der Bündelung von »Demografiedebatten, Migrantendebatten und Sozialstaatsdebatten« zum Ausdruck komme. Er schlug die Verbindung zur »liberalen Migrantenfurcht«. Deren Gesicht sei »weiblich und feministisch« und trage »Namen wie Alice Schwarzer und Necla Kelek«. Aber auch »bekennende Juden« tauchten gelegentlich auf, »die vor einer dritten totalitären Welle nach Kommunismus und Faschismus warnen«, während der Neuköllner Bürgermeister Buschkowsky »durch betont berlinernden Klartext den redlichen kleinen Mann« einbinde. In der Summe bekomme so, das ist der Kern von Seibts Kritik, »die immerwährende Furcht vor Fremden, die im Streit um Asylanten und Neonazis der Neunzigerjahre noch durch Lichterketten und Aufrufe zum Anstand eingedämmt werden konnte, einen aufgeklärten, zivilisierten Anstrich«. Seibt warnte demgegenüber: »Mit Furcht vor dem Neuen wurde noch nie etwas erreicht.«12 Er benutzte damit ein Argument, das auch die Kernkraftbefürworter der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gern für sich in Anspruch nahmen.
Matthias Dusini wunderte sich, »dass gesellschaftliche Tabus neuerdings nicht von zornigen Künstlern, sondern von biederen Bankern und Botschaftern gebrochen werden«, während der etablierte Kunstbetrieb sich an der Aufrichtung von Tabus beteilige.13
Thea Dorn zitierte Martin Luther: Dessen Satz »Die Armut in der Stadt ist groß, aber die Faulheit viel größer« würde in heutigen Debatten »menschenverachtend« genannt werden. Heute gelte: »Verharmlosungen sind geschützt, Polemik gilt als Volksverhetzung. … Ein humanistisch gebildeter Berserker wie Franz Josef Strauß würde es heute allenfalls zum Bezirksbürgermeister von München-Maxvorstadt bringen.«14
Heribert Seifert meinte, Thilo Sarrazin habe mit seinem Buch »eine jener deutschen Debatten angestoßen, in denen der Zuschauer nur mit Mühe unterscheiden kann, ob es um die Klärung strittiger Sachen geht oder um die Kontrolle der öffentlichen Meinung«. Hier verletze »ein Mitglied der deutschen Funktionselite den Sprachcode, den die politische Klasse ebenso wie die medialen Meinungsführer für die öffentliche Erörterung der Einwanderung und ihrer Folgen für alternativlos erklärt haben«. Sarrazin »öffne dem Unmut über solche vormundschaftliche Hege und Pflege der öffentlichen Debatte ein Ventil«. Dadurch werde aber »durchaus nicht primär tobsüchtiges Ressentiment freigesetzt«, vielmehr treffe man bei »den Tausenden von Leserbriefen und Leserkommentaren auf engagierte Diskussionsbeiträge oft sehr sachkundiger Bürger«.15
[inner_post 3] Henryk M. Broder zitierte einen Demonstrationsaufruf in Mainz gegen die »Sarrazins und den allgemeinen Rassismus und den Hass auf die Armen«. Dort hieß es, »Thilo Sarrazin und andere sprechen keine unbekannten Wahrheiten aus, sie brechen keine Tabus und sind keine Verteidiger der Meinungsfreiheit«. Nichts von dem, was Sarrazin beschreibe, sei »eine Bereicherung für die Diskussion, neu, originell oder ein Tabubruch«. Broder wunderte sich folgerichtig über die ganze Aufregung: »Wenn ›Sarrazin und andere‹ keine unbequemen Wahrheiten aussprechen, wenn sie keine Tabus brechen, wenn nichts von dem, was sie sagen, neu, originell oder eine Bereicherung für die Diskussion ist, dann ist doch alles, was Sarrazin und andere von sich geben, kalter Kaffee – und nicht wert, dass man sich darüber aufregt.«16
Damit brachte er die Paradoxie eines Teils der Debatte wunderbar auf den Punkt. Und nun die Liste der Tabus, die offenbar berührt wurden, obwohl es sie doch angeblich gar nicht gibt:
Differenzierung nach Gruppen
In meinem Buch hatte ich in wechselnden Zusammenhängen gruppenbezogene Unterschiede bei der Bildungsleistung, dem wirtschaftlichen Erfolg und dem Grad der Integration angesprochen. Dabei hatte ich, soweit dies statistisch möglich war, nach der ethnischen Herkunft wie nach der religiösen Prägung differenziert. Wo es um das überdurchschnittliche Abschneiden von Gruppen ging – etwa Juden, Chinesen, Vietnamesen, Inder –, wurde dies in der Rezeption kaum, bzw. – im jüdischen Falle – gar nicht erwähnt. Wo es um das unterdurchschnittliche Abschneiden von Gruppen ging, war dagegen emotionale Empörung – nicht über die Tatsachen, sondern über deren Beschreibung – die vorherrschende Reaktion. Natürlich versuchte man auch gleich, die Antisemitismus-Karte zu ziehen. Harry Nutt zitierte Heinrich von Treitschkes »fatalen Aufsatz« aus dem Jahr 1879, Unsere Aussichten, in dem sich dieser kritisch zur Integration der jüdischen Einwanderer aus Osteuropa geäußert hatte. Dieser Aufsatz »lese sich wie eine Blaupause für aktuelle populistische Pamphlete«.17 Nutt verschwieg nur die Pointe: Die Problematik der jüdischen Einwanderer bestand Ende des 19. Jahrhunderts darin, dass sie so besonders erfolgreich waren. Sie gründeten Banken, füllten die Gymnasien und stürmten akademische Positionen. Es war also das exakte Gegenteil der in meinem Buch angesprochenen Probleme.
Religion und Integration
Im Falle der muslimischen Migranten überlagern sich die gruppenbezogenen Unterschiede mit der religiösen Orientierung. In meinem Buch hatte ich dazu die statistischen Fakten beschrieben. Mit kausalen Erklärungen war ich vorsichtig, und immer wieder hatte ich klargemacht, dass eine statistische Beschreibung von Häufigkeitsverteilungen in Gruppen keine Aussage für den Einzelfall zulässt. Damit tat sich die Rezeption in Politik und Medien äußerst schwer. Die bloße Erwähnung statistischer Fakten zu Sprachkenntnissen, Bildungsbeteiligung oder Kriminalität wurde als diskriminierende Zuschreibung zum Einzelfall angesehen, die Diskussion auf der Faktenebene gleichzeitig aber weitgehend verweigert. Wo man ihr nicht entgehen konnte, schlug sie schnell um in persönliche Diffamierungen, die bis zum Rassismusvorwurf gingen.
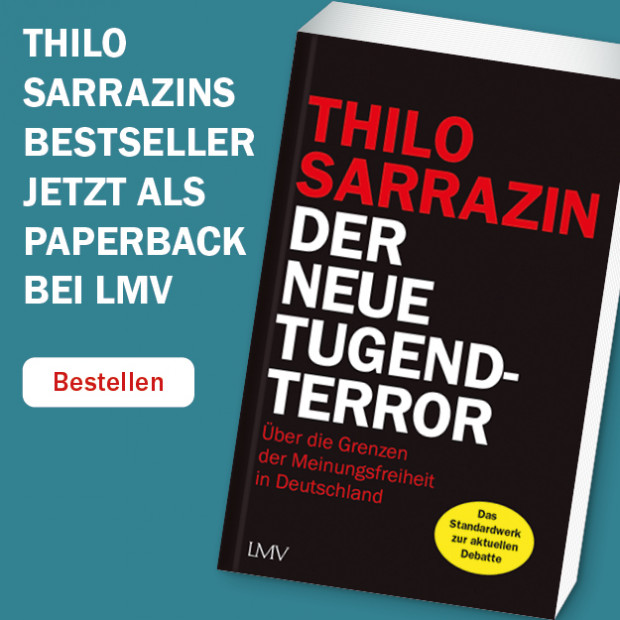 Da half es auch kaum, dass meine Analysen weitgehend identisch waren mit Einschätzungen von Autoren wie der Soziologin Necla Kelek oder des Politikwissenschaftlers Hamed Abdel-Samad. Letzterer sagte: »Der Islam ist wie eine Droge … und auf dem Weg ins Abseits. Der Islam muss nicht verteufelt werden, er muss sich von Grund auf modernisieren.«18
Da half es auch kaum, dass meine Analysen weitgehend identisch waren mit Einschätzungen von Autoren wie der Soziologin Necla Kelek oder des Politikwissenschaftlers Hamed Abdel-Samad. Letzterer sagte: »Der Islam ist wie eine Droge … und auf dem Weg ins Abseits. Der Islam muss nicht verteufelt werden, er muss sich von Grund auf modernisieren.«18
In den Medien aber dominierte das Jammern jener, die sich als Opfer meiner Analysen darstellten: Hilal Sezgin (Mutter deutsche Professorin, Vater türkischer Professor) klagte in der Zeit unter der Überschrift »Deutschland schafft mich ab«, »Einmal Muslim, immer Fremder« und hielt jedwede Diskussion und Analyse über gruppenbezogene Unterschiede prinzipiell für illegitim: »Wirklich angemessen wäre nur eine Karte im Maßstab 1:1.«19 Damit fordert Hilal Sezgin, auf vergleichende Untersuchungen sozialer Gruppen grundsätzlich zu verzichten. Es scheint ihr gleichgültig, dass diese Haltung, zu Ende gedacht, auf die Abschaffung einer empirischen Soziologie hinausläuft.

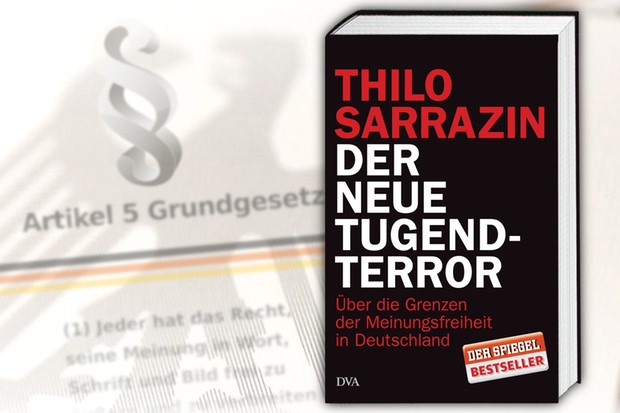





0 Kommentare