Es ist nicht mehr möglich, durch eine deutsche Stadt zu wandeln, ohne auf Schritt und Tritt Graffiti sehen zu müssen. Wir sollten uns davor hüten, sämtliche Graffiti für „Street Art“ zu halten, selbst wenn bekanntlich, wie ganz allgemein, zwischen Schmierereien und „echter Kunst“ fließende Übergänge bestehen. Strafrechtlich gelten Graffiti als Sachbeschädigung. In Deutschland entsteht durch sie pro Jahr ein Schaden von 200 Millionen Euro.
Soziologische Untersuchungen zeigen, dass 80 Prozent aller Graffiti von jungen Männern zwischen 18 und 20 Jahren stammen. Trotzdem sollten wir nicht übersehen, dass nicht alle Graffiti lediglich Schmierereien um ihrer selbst willen sind, denn nicht weinige unter ihnen enthalten politische Botschaften.
[inner_post 1] In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, das Auftreten von Graffiti in anderen Ländern zu betrachten. Dabei stellt sich heraus, dass diese in autoritären Staaten wie China, Kuba oder dem Iran keineswegs chaotisch sind, sondern gezielt zur Vermittlung von politischer Propaganda dienen.
Aufschlussreicher für die Beurteilung von Wandschmierereien in Deutschland ist der Blick auf ein anderes demokratisches Land, nämlich Japan. Dabei zeigt sich, dass man dort beinahe vergeblich nach ihnen sucht und dass der öffentliche Raum auch sonst wesentlich sauberer ist als in Deutschland. Während ein Sprayer, sollte er erwischt werden, in Deutschland mit einem Bußgeld von fünf Euro davonkommt, muss er in Japan zwei bis drei Monate einsitzen.
Graffiti sind hierzulande, wo seit einigen Jahren das Wort „verboten“ aus dem Wortschatz gestrichen wurde, das Ergebnis einer falsch verstandenen Permissivität, die absolut nichts mit Toleranz zu tun hat. Sie sind vielmehr sichtbare Zeichen für die fortschreitende Missachtung der öffentlichen Ordnung in einem Land, dessen Sozialleistungen man zwar gerne in Anspruch nimmt, dem man aber sonst keine wie immer geartete Achtung entgegenbringt. Auch durch die allenthalben an den Tag gelegte Freizügigkeit kann sich die deutsche Öffentlichkeit keine Sympathien oder gar Respekt erkaufen, sondern das Gegenteil.
Max von Tilzer war Professor für Aquatische Ökologie an der Universität Konstanz und von 1992 bis 1997 wissenschaftlicher Direktor des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven.

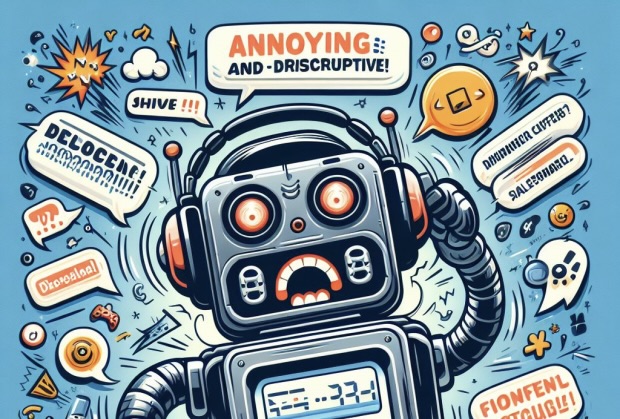
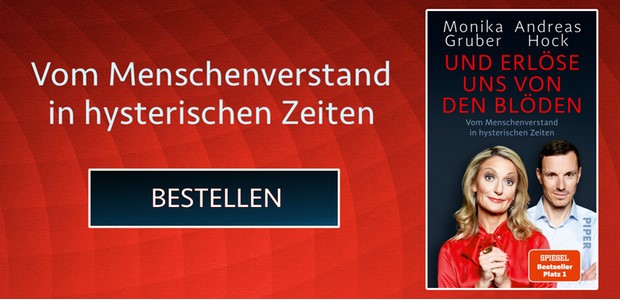





0 Kommentare