Dem Artikel zu jenem »Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung« ist zu entnehmen, es handele sich um »eine private interdisziplinäre Forschungseinrichtung« die sich, wie es später neutralisierend heißt, als »zwar tendenziell linkes, aber parteipolitisch und organisationspolitisch unabhängiges Institut« verstehe. Immerhin findet sich ein kleiner Abschnitt zur »Kontroverse« über das DISS. Doch die angeführten Kritiker werden – anders als bei rechtsgerichteten Autoren und Institutionen – nicht gänzlich wertungsfrei zitiert, sondern durch zahlreiche »gegenkritische« Bemerkungen in ihrer Glaubhaftigkeit und Seriosität zu erschüttern versucht.
Eine Große Anfrage von CDU-Abgeordneten im Bundestag bezüglich des »Verdachts der finanziellen Förderung linksextremistisch beeinflusster Initiativen durch das ›Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt‹« hätte »zu keinem Ergebnis« geführt. Tim Peters, Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin, hätte in seiner Dissertation eine Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung »behauptet«. Der Begriff suggeriert, dass diese Feststellung nicht verifizierbar sei. Dabei findet sich sogar in der online einsehbaren DISS-Publikation »Stimmungsmache. Extreme Rechte und antiziganistische Stimmungsmache« der ganz offene Hinweis: »Wir danken für die Förderung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung.«
[inner_post 4] Die Kritik am DISS durch den Journalisten Felix Krautkrämer wird wiederum als »Wehren« gegen Rechtsextremismusvorwürfe bezeichnet. Gegen Krautkrämers Recherchen werden zudem die SPD-Politiker Stephan Braun und Mathias Brodkorb mit Gegenstellungnahmen eingehend zitiert, die das DISS auf diese Weise in Schutz nehmen. Die Kritik durch den FAZ-Redakteur Lorenz Jäger wird schließlich mittels einer Einschätzung durch Jürgen Habermas zu entkräften versucht: Jäger sei »als Rechtsaußen der FAZ-Feuilleton-Redaktion einschlägig bekannt«. Weitergehende kritische Arbeiten werden im Eintrag erst gar nicht genannt, weder die ausführliche Analyse in »Das ›antifaschistische Milieu‹« des Autors dieser Zeilen noch die kritischen Bemerkungen durch den Gewerkschaftsmitarbeiter Wolfgang Kowalsky im Jahr 1992, noch die 2004 beim Institut für Staatspolitik (IfS) erschienene Schrift »Kritik als Ideologie. Die ›Kritische Diskursanalyse‹ des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS)«.
Ein Blick nach rechts: Das Institut für Staatspolitik wird eingangs sogleich kategorisierend als »private Einrichtung, die nach eigenen Angaben als Organisations- und Aktionsplattform für neurechte Bildungsarbeit dienen soll«, vorgestellt. »Es gilt als Denkfabrik der Neuen Rechten.« Mehrere Kritiker werden in dem Eintrag unwidersprochen zitiert. Während sich im DISS-Artikel unter »Literatur« keine dem Institut kritisch gegenüberstehenden Publikationen finden, werden hier gleich vier Schriften von politischen Gegnern genannt, darunter drei des DISS-Mitarbeiters Helmut Kellershohn.
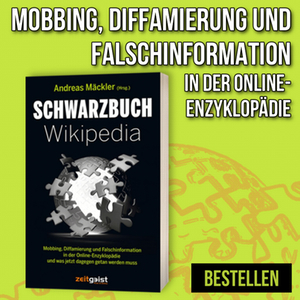 Ein Blick nach links: Kellershohn wiederum wird bei Wikipedia als »deutscher Historiker und Rechtsextremismusforscher« aufgeführt. Eine politische Kategorisierung findet nicht statt, wenngleich zu lesen ist, er sei nach eigenen Angaben »als Student in der 68er-Bewegung aktiv« gewesen und habe in diversen linkssozialistischen und kommunistischen Blättern publiziert, unter anderem in einer Schrift des Parteivorstands der PDS. Eine von Kellershohn herausgegebene Publikation wird als »anerkannter Sammelband« hervorgehoben, die Quellenangabe dazu nennt indes die Buchbesprechung eines politisch nahestehenden Autors.
Ein Blick nach links: Kellershohn wiederum wird bei Wikipedia als »deutscher Historiker und Rechtsextremismusforscher« aufgeführt. Eine politische Kategorisierung findet nicht statt, wenngleich zu lesen ist, er sei nach eigenen Angaben »als Student in der 68er-Bewegung aktiv« gewesen und habe in diversen linkssozialistischen und kommunistischen Blättern publiziert, unter anderem in einer Schrift des Parteivorstands der PDS. Eine von Kellershohn herausgegebene Publikation wird als »anerkannter Sammelband« hervorgehoben, die Quellenangabe dazu nennt indes die Buchbesprechung eines politisch nahestehenden Autors.
Eine ähnliche Wertschätzung wird dem »antifaschistisch« orientierten Autor Andreas Speit zuteil, bereits in der Einleitung wird lobend erwähnt: »Er gilt als einer der besten Kenner der rechtsextremen Szene in Deutschland.« Weiter heißt es, er gehöre »zu den renommiertesten Experten für den Rechtsextremismus, der in zahlreichen Medien zitiert und interviewt sowie von Wissenschaftlern und anderen Fachautoren rezipiert wird«. Obwohl Speit in zahlreichen Zeitschriften der politischen Linken (Jungle World, der rechte rand, Freitag) publiziert hat, wird auch er neutral als »deutscher Journalist und Publizist« signifiziert. Die dargestellten ausgedehnten Aktivitäten sowie die breite Medienrezeption zeichnen ein einseitig positives Bild, kritische Stimmen zu Speit werden nicht zitiert. Sowohl »Maegerle« als auch Speit werden im Artikel über den Journalisten Felix Krautkrämer, der sich ihrer Arbeit kritisch gewidmet hatte, als »Fachjournalisten für Rechtsextremismus« bezeichnet. Während Krautkrämers Analysen abfällig kommentiert werden, sind die Einträge von »Maegerle« und Speit »blütenrein«: Worte wie »anerkannt« (Kellershohn) oder »renommiert« (Speit) unterstreichen dies. Ein Seitenblick auf die Einträge zu den Nobelpreisträgern des Jahres 2017 zeigt, dass sich dort solcherart Beschreibungen in keinem einzigen Fall finden. Offenbar sind diese Begriffe überflüssig bei Personen, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistungen wirklich weitgehend anerkannt sind.
Wikipedia und die Beeinflussung »von oben«
Häufig kann der einzelne Medienvertreter nicht isoliert betrachtet werden. Seine Tätigkeit, inklusive der Filterung und sprachlichen Präsentation von Informationen, richtet sich auch an Vorgaben »von oben« aus oder orientiert sich zumindest daran. Verleger, Chefredaktion, Anzeigenkunden, mächtige Politiker – mit all diesen Gruppen möchte sich der kleine Redakteur selten anlegen, versucht also mehr oder minder deren Erwartungen zu erfüllen, um seine Existenz nicht zu belasten.
Was für hierarchisch gegliederte Medien zutrifft, ist zwar nur bedingt auf ein offenes Social-Media-System wie Wikipedia übertragbar, dennoch existiert auch hier Einflussnahme. An der Online-Enzyklopädie kann jeder Mensch sofort – offen oder anonym, also ohne dass der Autor für den Text haftbar gemacht werden kann – mitschreiben. Anschließend können die Einträge umgehend von anderen verändert werden. Eine gewisse Kontrollfunktion liegt allein bei den Administratoren, bewährten, langjährigen Wikipedia-Nutzern.
[inner_post 5] Keinesfalls aber ist damit gesagt, dass alle Autoren ganz frei und selbstständig ihre Positionen posten. In der Vergangenheit kam es öfters zu Fällen der organisierten Einflussnahme. Unternehmen, Lobbyorganisationen und PR-Firmen wurden bezichtigt, gezielt manipulativen Einfluss auf einzelne Artikel zu nehmen. Bekannt ist zudem, dass die Büromitarbeiter von zahlreichen Politikern auf Anweisung bei Wikipedia aktiv sind. Insofern ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es gerade in den sensiblen politischen Streitfällen auch Bemühungen einer organisierten politischen Einflussnahme gibt. Selbstverständlich ist davon auszugehen, dass politische, gesellschaftliche und staatliche Institutionen die Bedeutung der geistigen Einflussnahme durch ein viel genutztes Angebot wie Wikipedia längst erkannt haben. Wer will also noch annehmen, dass hinter den »Edit-Wars« allein Computer-Nerds mit viel Tagesfreizeit stecken, die zu fast jeder Tageszeit am Rechner sitzen und Beiträge umgehend löschen und verändern? Ebenso gut könnte es sich um mehrere Personen unter einem Nickname handeln, die sich ablösen. Oder um mehrere Autoren mit Nicknames, die in engem Kontakt miteinander stehen, sich die Bälle zuspielen – und eventuell auf der Lohnliste von jemandem stehen, der gar nicht selbst in Erscheinung tritt. Möglichenfalls handelt es sich sogar um ganze Büros, die nur mit dieser Tätigkeit beauftragt sind. Das sind natürlich Vermutungen, die stets nur in Einzelfällen, wenn ein »Skandal« durch gewisse Zufälle öffentlich wird, nachweisbar werden.
Es wäre naiv, das 2001 gegründete Social-Media-Projekt Wikipedia so zu verstehen, dass hier alle Nutzer friedlich und diskussionsoffen ihr Wissen beitragen, wodurch in einer Art herrschaftsfreiem Diskurs inhaltlich abgewogene Einträge entstehen, die das Wissen der Menschheit sammeln.
Dieses Prinzip mag bei botanischen oder geografischen Themen funktionieren, sobald die Artikel aber in einen gesellschaftlich umkämpften Bereich hineinreichen, beginnen andere Mechanismen zu greifen. In der Folge bleibt letztlich der Eintrag bei Wikipedia stehen, welcher am aggressivsten durchgesetzt wurde. Es »gewinnt« also nicht das bessere Argument, sondern die Thesen derjenigen Wikipedia-Autoren, welche über die meiste Zeit verfügen, um am Rechner zu sitzen – und/oder das größere Interesse haben, bestimmte Positionen durchzupauken, womöglich im Verbund mit zwei, drei Gesinnungsfreunden, die sich ebenfalls als Autoren betätigen. Politische Kraft- und Machtverhältnisse übertragen sich somit auf Lexikoneinträge. Wikipedia beruht solcherart auf einem sozialdarwinistischen Prinzip – der Hartnäckigere, »Stärkere« setzt sich durch. Manche Beiträge, vor allem im politischen Bereich, beruhen auf purem Durchsetzungswillen, auf der Besessenheit, den eigenen Standpunkt zu verbreiten. Wer mehr Mitstreiter hat, mehr Freizeit und mehr Aggressionspotenzial, kann die Formulierungen durchdrücken, die er haben möchte – die damit einhergehenden Beleidigungen und latenten Drohungen sind im Diskussionsbereich nachzulesen.
Wikipedia-Artikel bilden mit ihren spezifischen Formulierungen also Machtverhältnisse ab. Wer die Macht hat, entscheidet, wie Wirklichkeit gesehen werden soll. Dabei bleibt die Objektivität oft auf der Strecke. Wird der »Edit-War« zu stark, können Administratoren zwar schlichtend eingreifen, doch was ist, wenn politische Freunde, die bereits lange Zeit bei Wikipedia als Nutzer tätig waren, längst selber zu Administratoren mit weitergehenden Steuerungsbefugnissen »aufgestiegen« sind?
Fazit: Wikipedia ist nur bedingt als seriöse Informationsquelle anzusehen. Sie hat, auch wenn das die vielen aufrichtigen, kompetenten und gut meinenden Mitarbeiter nicht gerne hören, nichts mit einer klassischen Enzyklopädie gemein, die üblicherweise von namentlich verantwortlichen Wissenschaftlern zusammengetragen wird. Sicherlich eignen sich die Artikel, um sich schnell über Basisinhalte zu informieren. Ansonsten sind sie aber stets kritisch zu betrachten, da sie zwangsläufig dem Risiko politischer Manipulation ausgesetzt sind.
Claus Wolfschlag, Politologe und Autor zahlreicher Bücher, u.a. zu Themen des Widerstands in der NS-Zeit, zu Linksradikalismus, Film und Kunst. Wir danken für die freundliche Genehmigung zur Übernahme seines Beitrags aus:
Andreas Mäckler (Hg.), Schwarzbuch Wikipedia. Mobbing, Diffamierung und Falschinformation in der Online-Enzyklopädie und was jetzt dagegen getan werden muss. Zeitgeist print & online, 364 Seiten, 19,90 €
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>

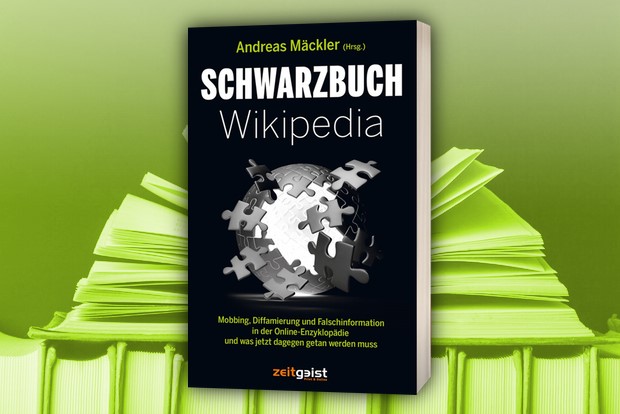
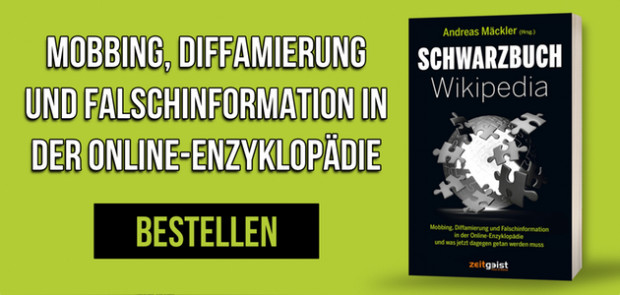





0 Kommentare