Tendenziell ist feststellbar, dass rechtsgerichtete Personen und Institutionen in der Online-Enzyklopädie als solche benannt und kategorisiert werden. Bei linksgerichteten Personen und Institutionen ist das häufig nicht der Fall, sofern die Person nicht so prominent ist, dass ein Verschweigen bestimmter Sachverhalte des Lebenslaufs auffallen würde. Zudem dürfte die Einstufung als »rechts« stärker ins Gewicht fallen, denn viele Leser sind durch die Erziehung und die Medien in der Bundesrepublik Deutschland vorgeprägt und assoziieren mit dem Begriff »rechts« negative Bilder. Eine diesbezügliche Kategorisierung kann also dazu führen, dass sie überschnell eine ablehnende Haltung gegenüber der beschriebenen Person oder Institution einnehmen, ohne sich je eingehender mit ihr beschäftigt zu haben. Als Rückkopplungseffekt kann es zu sozialen Schäden bei den so kategorisierten Personen kommen.
b.) Darstellung als »umstritten« – Zitieren kritischer Gegenstimmen
Wird eine Position als »umstritten« bezeichnet, so versteckt sich dahinter weniger das Ansinnen, das Für und Wider von Argumenten abzuwägen. Dann wäre die Erwähnung ja auch überflüssig, da fast jede Person des öffentlichen Lebens und fast jede politische Position in irgendeiner Weise »umstritten« ist. Es geht um etwas anderes. Vielmehr werden nämlich in Beiträgen Personen zitiert, die sich großenteils negativ oder skeptisch äußern. Aus welchen Interessen heraus, bleibt dabei unerwähnt. Der Kritiker, gern auch »Experte«, erscheint wie eine neutrale Gutachterinstanz, sein politischer Standort wird nicht thematisiert. Von dieser Warte aus wird die vorgestellte Person oder Institution dem Leser wahlweise als »abseitig«, »unseriös«, »politisch radikal« oder »extrem« zu vermitteln versucht. Bei anderen Personen oder Institutionen wird auf das Zitieren kritischer Gegenstimmen verzichtet. Ihre Position wird als über jede Kritik erhaben dargestellt, sie selbst erscheinen als seriös oder renommiert und mit »gutem Ruf« ausgestattet.
Während die Artikel über rechtsgerichtete Personen oder Institutionen häufig mit kritischen Gegenstimmen garniert werden, findet sich das bei linksgerichteten Personen und Organisationen tendenziell weniger. Das betrifft ganz besonders solche Publizisten, die dem »antifaschistischen Milieu« zugehören, also in starkem Maß in den »Kampf gegen rechts« verstrickt sind.
c) Mücken werden zu Elefanten, und dunkle Flecken verschwinden einfach
Ein weiteres Instrument, das in den Wikipedia-Artikeln angewendet wird, um eine Person oder Institution ins gewünschte Licht zu rücken, besteht darin, einzelne Aspekte – Werke, Äußerungen oder auch Verfehlungen – zu betonen und ihnen dadurch ein übergroßes Gewicht zu verleihen. Bei anderen hingegen werden »dunkle Flecken« vertuscht: einfach nicht erwähnt. Solche inhaltlichen Verkürzungen und Formulierungen sind auch bekannt aus der klassischen »antifaschistischen« Anprangerungsliteratur. Aus dem Programm eines als rechts geltenden Verlags wird beispielsweise nur zitiert, was negative Konnotationen hervorruft, andere Verlagspublikationen werden verschwiegen oder in proportional geringerem Maß erwähnt, also marginalisiert.
Im Folgenden sollen einige Beispiele aus dem »linken« bzw. »rechten« Spektrum verdeutlichen, wie die politische Tendenz der beschriebenen Personen und Institutionen bei Wikipedia kenntlich zu machen versucht wird.
Ein Blick nach rechts: Der Artikel über den österreichischen Leopold Stocker Verlag enthält bereits im Einleitungstext eine politische Markierung, da dort »im eigenen Haus wie auch im Tochterunternehmen Ares Verlag rechtskonservative Literatur mit Schnittpunkten zum Rechtsextremismus« verlegt würde. Darüber hinaus wird explizit auf »deutschvölkische« Titel im Verlagsprogramm der Vergangenheit hingewiesen.
[inner_post 3] Ein Blick nach links: Beim PapyRossa Verlag finden sich solch detaillierte Kategorisierungen nicht, obwohl er sogar vonseiten der linken Szene in den eigenen Reihen verortet wird. Im Eintrag heißt es schlicht: »ein Verlag mit Sitz in Köln«. Zum Verlagsprogramm wird nur sehr allgemein verlautbart, es umfasse »Politik, (Sozial-)Geschichte, Ökonomie, Feminismus, Bildung und Schule, Familie, Fußball sowie die Reihen Basiswissen Politik/Geschichte/Ökonomie und Hochschulschriften«. Dass dort zum Beispiel Bücher wie »Kapitalismus« des DKP-Mitglieds Georg Fülberth verlegt werden, »Rassismus und Antirassismus« des ehemaligen SDS-Mitglieds und Marxisten Wulf D. Hund, »Wenn die Linke fehlt« des italienischen Kommunisten Domenico Losurdo oder ein Sammelband der Linksjugend Solid, wird nicht weiter thematisiert.
Ein Blick nach links: Im Eintrag »Anton Maegerle« findet sich bezeichnenderweise nicht einmal der bürgerliche Name des »antifaschistisch« ausgerichteten Journalisten – ein selbst für Wikipedia sehr ungewöhnliches Faktum. Der Autorenname ist nämlich nur das Pseudonym für Gernot Modery. Zwar wird später erwähnt, dass »Maegerle« SPD-Mitglied ist und sich publizistisch und organisatorisch in der Partei engagiert, er selbst wird aber politisch neutral nur als »ein deutscher Journalist und Autor« vorgestellt, also nicht als sozialdemokratischer oder linker Autor. Einige kleinere Chroniken aus seiner Feder im Magazin Stern werden unter der Kategorie »Fachartikel« eingeordnet. Zur Rezeption seiner Publikationen erscheint nicht die sonst übliche Überschrift »Kritik«, hier heißt es »Angriffe«. Während also »der deutsche Journalist und Autor« »Anton Maegerle« nur »beobachtet«, »verfasst«, »aufdeckt«, »auswertet« und »protokolliert«, werden seine Kritiker als Angreifer dargestellt, so als käme eine Aggression nur von ihrer Seite. Diese Gegner werden im Gegensatz zur politisch weitgehend neutralen Darstellung »Maegerles« als »Neurechte und Rechtsextremisten«, sogar als »Neonazis« politisch kategorisiert. Verschwiegen wird, dass »Maegerle« auch in der Zeitschrift der rechte rand publiziert hat, die 1998 im Verfassungsschutzbericht des Bundes als »organisationsunabhängige linksextremistische bzw. linksextremistisch beeinflusste Publikation« mit Verbindungen zur von der DKP beeinflussten Gruppierung VVN/BdA eingestuft wurde. Stattdessen wird explizit erwähnt, dass »Maegerle« »wegen seiner beruflichen Tätigkeit Anfeindungen und Bedrohungen bis hin zu Mordaufrufen von Neonazis ausgesetzt« sei.
Ein Blick nach rechts: Der Historiker Karlheinz Weißmann wird politisch eindeutig als »ein Buchautor und Hauptvertreter der deutschen Neuen Rechten« kategorisiert. Als Kritiker wird der »Sozialwissenschaftler Gerhard Schäfer« zitiert, welcher vor allem durch einige wenige »antifaschistisch« motivierte Arbeiten in Erscheinung getreten ist. Dass es vor einigen Jahren nicht bei »Anfeindungen und Bedrohungen« geblieben ist, sondern einen politisch motivierten Anschlag auf Weißmanns Haus gegeben hat, bei dem Fenster zerbrochen sind, Lackfarbe an die Fassade geschmiert und ins Hausinnere auf Bücher, Möbel und Böden geworfen wurde, bleibt unerwähnt, obwohl der Vorgang seinerzeit öffentlich gemacht wurde.
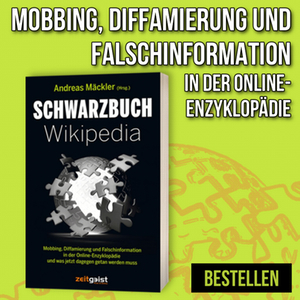 Ein Blick nach links: Auch Siegfried Jäger, der Gründer des »Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung« (DISS), wird politisch neutral als »ein deutscher Sprachwissenschaftler« bezeichnet, der »diskursanalytisch zu Rassismus und Rechtsextremismus« forsche. Einen Hinweis auf die von Jäger und dem DISS-Institut vertretene »antirassistische« Theorie und deren Verbreitungsbemühungen durch Forderungen an Medienvertreter findet man nicht, ebenso wenig, dass Jäger weiten Teilen der bundesdeutschen Presselandschaft, von Bild über FAZ, Focus bis zur Zeit und dem Spiegel »Rassismus«, »Neokonservatismus« und »völkischen Rassismus« vorgeworfen hat. Überhaupt sei nach seiner Meinung in der Bundesrepublik der Versuch der 68er-Bewegung, »mehr Demokratie zu wagen«, durch ein »völkisch-nationalistisch« zu bezeichnendes Gesellschaftsmodell gestoppt worden. Um der schleichenden Umwandlung in eine »ultrakonservative und reaktionäre« Gesellschaft vorzubeugen, propagierte er 1992 die Erteilung von Mitbestimmungsrechten an Einwanderer »in viel größerem Maße«. Jäger plädierte zudem bei seiner Ansicht nach »volksverhetzenden« Publikationen für Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, »alle rechtsextremen Parteien, einschließlich der Republikaner«, sollten verboten werden. Von alledem findet sich in der Online-Enzyklopädie nichts.
Ein Blick nach links: Auch Siegfried Jäger, der Gründer des »Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung« (DISS), wird politisch neutral als »ein deutscher Sprachwissenschaftler« bezeichnet, der »diskursanalytisch zu Rassismus und Rechtsextremismus« forsche. Einen Hinweis auf die von Jäger und dem DISS-Institut vertretene »antirassistische« Theorie und deren Verbreitungsbemühungen durch Forderungen an Medienvertreter findet man nicht, ebenso wenig, dass Jäger weiten Teilen der bundesdeutschen Presselandschaft, von Bild über FAZ, Focus bis zur Zeit und dem Spiegel »Rassismus«, »Neokonservatismus« und »völkischen Rassismus« vorgeworfen hat. Überhaupt sei nach seiner Meinung in der Bundesrepublik der Versuch der 68er-Bewegung, »mehr Demokratie zu wagen«, durch ein »völkisch-nationalistisch« zu bezeichnendes Gesellschaftsmodell gestoppt worden. Um der schleichenden Umwandlung in eine »ultrakonservative und reaktionäre« Gesellschaft vorzubeugen, propagierte er 1992 die Erteilung von Mitbestimmungsrechten an Einwanderer »in viel größerem Maße«. Jäger plädierte zudem bei seiner Ansicht nach »volksverhetzenden« Publikationen für Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, »alle rechtsextremen Parteien, einschließlich der Republikaner«, sollten verboten werden. Von alledem findet sich in der Online-Enzyklopädie nichts.
Ähnlich verhält es sich bei Jägers Ehefrau Margret Jäger, mit der er eng zusammenarbeitet. Sie wird in der Kopfzeile ihres Wikipedia-Eintrags als »Sprachwissenschaftlerin und Leiterin des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung« bezeichnet. Eine politische Kategorisierung fehlt. Immerhin wird in den wenigen Zeilen zur »politischen Biografie« kurz erwähnt, dass sie »dem 1. Bundesvorstand … der 1982 gegründeten Partei Demokratische Sozialisten« angehörte. Zudem liest man: »Margret Jäger war außerdem Mitherausgeberin der Zeitschrift Revier, die zeitweilig im Duisburger Margret Jäger Revier Verlag erschien, den sie von 1977 bis 1985 leitete.« Einzelheiten zu dieser linksgerichteten Publikation finden sich nicht, wohl aber an anderer Stelle im Internet.

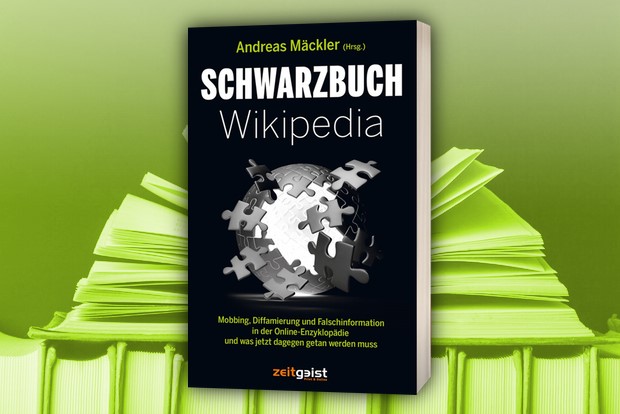





0 Kommentare