Die moralisierende Energie- und Klimapolitik – ineffektiv und ineffizient
Das Klimaproblem lässt sich aus ökonomischer Sicht als globaler negativer externer Effekt auffassen. Jede Emission von Treibhausgasen (THGs), unter denen CO2 die größte Rolle spielt, erhöht die Konzentration dieser Gase in der Atmosphäre und trägt so zur Destabilisierung des Klimas bei. Dieser Effekt ist extern in Bezug auf das Marktsystem, weil der Emittent dafür keinen Preis bezahlen muss; er ist negativ, da die Klimadestabilisierung zu Nutzeneinbußen und Kostensteigerungen führen wird; und er ist global, da es keine Rolle spielt, wer wo wieviel emittiert, sondern die Höhe der weltweiten Gesamtemission entscheidend ist. Dieser externe Effekt kann internalisiert werden, indem die Emissionen von THGs bepreist werden (durch eine Emissionssteuer oder ein Emissionsrechtehandelssystem) und so ein ökonomischer Anreiz zu deren Vermeidung geschaffen wird. Denn ein solcher Preis führt dazu, dass Prozesse und Güter im Verhältnis ihrer Emissionsintensität verteuert werden und deshalb versucht wird, neue, klimafreundlichere und damit kostengünstigere Technologien einzuführen. Der Preis schafft einen Anreiz für Unternehmer und Konsumenten, nach den günstigsten Vermeidungsmöglichkeiten zu suchen.
Vollkommen sinnlos sind dagegen Appelle zu Verhaltensänderungen, da es für die so angesprochenen Individuen nicht rational wäre, dieselben zu befolgen. Der Nutzen emissionsverursachender Aktivitäten kommt vollständig dem Emittenten zugute, aber die dadurch verursachten Schäden betreffen die gesamte Weltbevölkerung, also nur zu einem infinitesimalen Teil ihn selbst, sodass es aus individueller Sicht keinen Anlass gibt, das Verhalten zu ändern: Eine individuelle Emissionsreduktion würde den Nutzen des betreffenden Emittenten spürbar schmälern, aber praktisch keinen Beitrag zur Klimastabilisierung leisten. Es existiert hier ein Konflikt zwischen individueller Rationalität (eine individuelle Verhaltensänderung wäre irrational) und kollektiver Rationalität (eine Einschränkung der Gesamtemissionen ist sinnvoll und notwendig), wie er für externe Effekte typisch ist. Dieser Konflikt lässt sich nicht durch Appelle, sondern nur durch eine Anpassung der Rahmenbedingungen des individuellen Handelns beseitigen, also durch die Schaffung entsprechender ökonomischer Anreize. Denn die Verursacher des externen Effektes werden nur dann alle Kosten ihrer Aktivitäten bei ihren individuellen Entscheidungen berücksichtigen, wenn sie diese auch tragen müssen.
Diese Anreize müssen auf globaler Ebene und einheitlich gesetzt werden, da die Klimapolitik nur dann effektiv und effizient ist, wenn alle Emittenten aller Branchen und Wirtschaftssektoren in allen Ländern denselben Anreizen unterliegen. Nicht zielführend ist dagegen, was in Deutschland und in der EU gerade geschieht, dass sich nämlich einzelne Länder bzw. Ländergruppen Emissionsreduktionsziele setzen.
Schaut man sich die Zahlen zu den weltweiten Treibhausgasemissionen an, so wird schnell klar, dass die EU oder gar Deutschland allein bei weitem nicht in der Lage sind, für eine spürbare Reduktion der Gesamtemissionen und damit für eine Stabilisierung des Weltklimas zu sorgen. Im Jahr 2017 betrug laut Bundesministerium für Umwelt der Anteil der EU (ohne Deutschland) an den weltweiten Treibhausgasemissionen lediglich 7,3% (Deutschland hat einen Anteil von 1,9%). Zum Vergleich dazu betrug der Anteil der USA 13,7% und der von China 27,3%. Angesichts der absoluten Zunahme an Treibhausgasemissionen in China und Indien sinkt der Anteil der EU und Deutschlands Jahr für Jahr.
Ob die EU oder Deutschland sich ambitioniertere Emissionsziele setzt und diese – im günstigsten Fall – auch erreicht, wird auf globaler Ebene also kaum ausreichen, den gegenwärtigen Trend der Erwärmung zu stoppen oder gar umzukehren. Deshalb wäre es besser, in Abwesenheit einer international koordinierten Klimaschutzpolitik knappe Ressourcen in die Adaption an den Klimawandel zu investieren (z.B. in die Verstärkung der Nordseedeiche oder den Waldumbau), anstatt diese für wirkungslose Emissionsreduktionsanstrengungen zu verschwenden. (Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 stellt keine solche international koordinierte Klimaschutzpolitik dar, sondern ein unkoordiniertes Sammelsurium weitgehend unverbindlicher nationaler Aktionspläne.) Die deutsche Klimapolitik ist schon aus diesem Grund ineffektiv und damit nicht rational.
Hinzukommt, dass die Anstrengungen zur Emissionsreduktion, die Deutschland schon unternimmt und noch vorhat (abgesehen davon, dass sie so gut wie keine Auswirkungen auf das Klima haben bzw. haben werden), ineffizient sind, also höhere volkswirtschaftliche Kosten als nötig verursachen. Aus umweltökonomischer Sicht ist ein einheitlicher Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen notwendig, der entweder direkt durch eine Emissionssteuer oder indirekt durch ein Emissionszertifikatssystem eingeführt werden könnte. Im ersten Fall würde der Steuersatz festgelegt und die Emissionsmenge würde sich gemäß den Reaktionen der Emittenten ergeben; im zweiten Fall würde die Zertifikats- bzw. Emissionsmenge bestimmt und der Zertifikatspreis würde sich durch Angebot und Nachfrage am Markt bilden (»cap and trade«). Entscheidend ist, dass in beiden Fällen einheitlich vorgegangen wird, d.h. dass alle Emittenten in gleichem Maße belastet werden. Nur so können die Treibhausgasemissionen effektiv und effizient, d.h. zu den geringstmöglichen Kosten reduziert werden. Denn auf diese Weise würden die Kosten des Klimawandels den Verursachern angerechnet, und diese hätten einen Anreiz, die Treibhausgasemissionen zu senken. Dabei würden die Emittenten ihre Emissionen umso stärker reduzieren, je niedriger ihre Reduktionskosten sind, sodass insgesamt die Emissionsreduktion zu den geringstmöglichen Kosten erfolgen würde.
Im Gegensatz dazu ist die Klimapolitik in Deutschland – nach Meinung des Sachverständigenrats und des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium – kleinteilig, ineffizient und leistet (fast) keinen Beitrag zur klimapolitisch erwünschten Verringerung der Treibhausgasemissionen. Dies gilt vor allem für das im Jahr 2000 eingeführte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das den Ausbau erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung fördert. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hatte schon im Jahr 2004 darauf hingewiesen, dass die direkte Förderung erneuerbarer Energien durch das EEG innerhalb des übergreifenden EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) keinen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen erbringt, sondern nur zu einer Verlagerung in andere Länder führt. Und viele Experten fragen sich, wie wir mit regenerativen Energien und – auf absehbare Zeit – ohne ausreichende Stromspeicher die Versorgungssicherheit für den Industriestandort Deutschland in Zukunft gewährleisten können.
Der Kohleausstiegsbeschluss, die massive Förderung der Elektromobilität und das »Klimapaket 2030« sind weitere Weichenstellungen der deutschen Klimapolitik, die diese Linie fortführen. Angesichts eines solchen Vorgehens überraschen enorme Ineffizienzen bei der Reduktion von CO2-Emissionen nicht. Bei einem Vergleich der durchschnittlichen errechneten CO2-Vermeidungskosten (in Euro/t vermiedener CO2-Emissionen) kommt man je nach den getroffenen Annahmen zwar zu unterschiedlichen Aussagen, deren Grundtenor jedoch eindeutig ist: Die spezifischen CO2-Vermeidungskosten der Windenergie onshore belaufen sich demnach auf ca. 1.900 Euro und die der Photovoltaik auf ca. 1.874 Euro; für den Bereich der Elektromobilität sind die spezifischen Vermeidungskosten auf 1.100 bis 1.200 Euro/t zu veranschlagen.
Für den Kohleausstieg, dessen Gesamtkosten mindestens 100 Mrd. Euro betragen werden, lassen sich die Vermeidungskosten noch nicht genau beziffern, aber es deutet viel darauf hin, dass die Abschaltung modernen Kohlekraftwerke nicht die kostengünstigste Möglichkeit zur Reduktion von CO2-Emissionen darstellt. Wenn man diese hohen Vermeidungskosten dem derzeitigen Marktpreis im EU-ETS von ca. 40 Euro pro Tonne CO2-Emissionen gegenüberstellt, so ergibt sich ein Faktor von ca. 27 bis 48, um den die aufgeführten CO2-Vermeidungsmaßnahmen bzw. technologien teurer sind als der EU-ETS-Preis.
Es ist klar, dass wir mit diesen verschiedenen Maßnahmen bei weitem nicht die kosteneffizientesten Maßnahmen ergriffen haben und genau das Gegenteil einer volkswirtschaftlich effizienten Klimapolitik betreiben. Hinzukommt, dass diese nicht nur ineffizient, sondern größtenteils auch ineffektiv ist: So lässt sich im Fall der Stromerzeugung auf europäischer Ebene, nämlich innerhalb des übergreifenden EU-ETS, keine Vermeidungswirkung erzielen – zumindest nicht ohne weitere Maßnahmen, die ihrerseits zusätzliche Kosten verursachen würden. Es sind hier zwei Arten von Ineffektivität zu unterscheiden: Zum einen ist, wie oben erwähnt, jede nur nationale bzw. nur europäische Politik deswegen ineffektiv, weil dadurch das Klima nicht beeinflusst werden kann. Zum anderen ist die deutsche Politik außerdem deswegen ineffektiv, weil sie auf europäischer Ebene die Emissionen nicht reduziert. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im Rahmen des »Green Deal« der EU soll die gegenwärtige, ineffektive und ineffiziente Klimapolitik weiterverfolgt und noch wesentlich intensiviert werden.
Ursächlich für diese Misere ist nicht etwa mangelndes Wissen um eine bessere Klimapolitik, sondern die bewusste Verweigerung einer rationalen Analyse des Klimaproblems und seiner möglichen Lösungen zugunsten einer emotionalen, gesinnungsbasierten und vorurteilsbehafteten Politik – mit anderen Worten: ursächlich ist der politische Moralismus. Denn, so Lübbe, »[e]s passt nicht ins Weltbild des Moralisten, dass, was er der Moral anvertraut wissen möchte, sich durch Entmoralisierung ungleich wirksamer bewerkstelligen lässt, und just dieses Faktum empört den konsequenten Moralisten mehr, als ihn die pragmatische Erledigung von Problemen je zu erfreuen vermöchte«.
Angesichts immer weiterer moralpolitischer Tabus hinsichtlich von Zielen, Instrumenten und Technologien einerseits und der zunehmenden Komplexität und Bürokratisierung wichtiger Bereiche andererseits werden die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft immer geringer. Dadurch verbauen wir uns in zunehmendem Maße die Chance, nachhaltige Problemlösungen für die Zukunft zu entwickeln und umzusetzen.
Politischer Moralismus – und kein Ende in Sicht?
Der politische Moralismus beschränkt sich nicht auf die Energie- und Klimapolitik, sondern ist charakteristisch für die gesamte gegenwärtige Politik in Deutschland (und in anderen Ländern). Die typischen Merkmale einer moralisierenden Politik sind besonders auffällig in der Flüchtlings- und Migrationspolitik sowie – ganz aktuell – in der Corona-Politik. In beiden Fällen wird emotional argumentiert und auf der Grundlage von Gesinnung und Moral entschieden; eine rationale und vorurteilsfreie Diskussion findet nicht statt, sondern wird im Gegenteil durch Ausgrenzung und Diffamierung von Kritikern soweit als möglich unterdrückt – mit bereitwilliger Unterstützung der meisten Medien.
Natürlich ist der politische Moralismus kein Kind des 21. Jahrhunderts. Schließlich warnte Hermann Lübbe schon vor über 35 Jahren vor ihm. Damals waren es Probleme wie Waldsterben oder Nachrüstung, die mitunter sehr emotional diskutiert wurden. In der Politik haben Moral und Gesinnung schon immer eine wichtige Rolle gespielt, was insofern kein Problem sein muss, als Gesinnungsethik nicht mit Verantwortungslosigkeit identisch sein und die Gesinnung nicht blind gegenüber Konsequenzen machen muss. In der Tat dominierten Gesinnungsethik und Moral die Politik zu der Zeit, als Hermann Lübbe seinen Essay verfasste, noch nicht in dem Maße, wie dies heute der Fall ist. Vielmehr gaben die Verantwortungsethiker in den etablierten Parteien, der Regierung und in den meisten Medien den Ton an. Der gesinnungsethische Standpunkt wurde – cum grano salis – nur von einigen zivilgesellschaftlichen Gruppen und der damals neuen Partei der Grünen vertreten.
Im Lauf der Zeit haben sich aber die Verhältnisse umgekehrt und die gesinnungsethische Position hat gegenüber der verantwortungsethischen Position immer mehr an Gewicht gewonnen und diese als herrschende politische Philosophie abgelöst. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war sicher die Einführung des Euro, die gegen den Willen der Bevölkerung und gegen die Ratschläge und ungeachtet der Warnungen praktisch aller Ökonomen durchgesetzt wurde – nur auf Grundlage einer europafreundlichen Gesinnung und reinen Wunschdenkens. Heute steht die Verantwortungsethik auf verlorenem Posten: Alle etablierten Parteien, die reichweitenstarken Medien und einflussreiche zivilgesellschaftliche Gruppen vertreten gesinnungsethische Positionen und bestärken sich gegenseitig in denselben. Angesichts dieses Kartells des politischen Moralismus kann sich die Stimme der Vernunft und der Verantwortung nicht nur nicht durchsetzen – sie kann sich nicht einmal Gehör verschaffen.
Die Gründe für den Siegeszug des politischen Moralismus wären eine ausführliche politökonomische Analyse wert. Eine solche können wir im Rahmen dieses Beitrags nicht leisten. Stattdessen wollen wir abschließend kurz überlegen, ob und unter welchen Umständen eine Rückkehr zu Vernunft und Verantwortung möglich ist.
Das Hauptproblem scheint in der Beliebtheit – oder zumindest der Akzeptanz – des moralisierenden Politikstils bei den Wählern zu liegen. Solange sich diese weiter mit Prinzipien, Gesinnung und Moral abspeisen lassen, haben die Politiker keinen Anreiz, von ihrer gesinnungsethischen Strategie abzugehen – und haben Politiker, die die Verantwortungsethik vertreten, wenig Aussichten, in Amt und Würden zu gelangen. Nur wenn die Wähler eine offene und vorurteilsfreie Diskussion verlangen; nur wenn sie Wert auf verantwortungsvolle und kritische Vernunft und Urteilskraft legen; und nur wenn sie erkennen, dass es angesichts der komplexen gesellschaftlichen Ordnungszusammenhänge mehr um die Etablierung abstrakter Regeln als um die Herbeiführung konkreter Ergebnisse gehen muss: nur dann besteht die Aussicht, dass der politische Moralismus zurückgedrängt und in der Politik wieder ein angemessenes Verhältnis zwischen Gesinnung und Verantwortung, zwischen Moral und Vernunft, zwischen Idealismus und Realpolitik hergestellt wird.
Es ist zu hoffen, dass die Wähler und Bürger zu dieser Einsicht gelangen, ohne dass es dafür notwendig ist, dass die Kosten und Probleme des politischen Moralismus noch weiter überhandnehmen, als dies jetzt schon der Fall ist.
Dr. Rupert Pritzl hat Volkswirtschaftslehre, Romanistik und Philosophie an den Universitäten Münster, Sevilla und Freiburg studiert. Seit 1997 ist er im Bayerischen Wirtschaftsministerium tätig und seit 2021 Lehrbeauftragter an der FOM Hochschule. Er gibt seine persönliche Meinung wieder.
Fritz Söllner ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Technischen Universität Ilmenau. Er war an der Universität Bayreuth als Privatdozent tätig und hat sich als John F. Kennedy Fellow an der Harvard University in Cambridge/USA aufgehalten. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrationspolitik, Umweltökonomie und die Geschichte des ökonomischen Denkens. 2019 ist von ihm im Springer-Verlag das Buch „System statt Chaos – Ein Plädoyer für eine rationale Migrationspolitik“ erschienen, 2021 im gleichen Verlag das Buch „Die Geschichte des ökonomischen Denkens“.


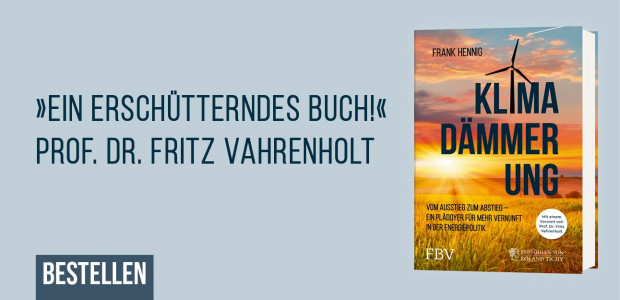





0 Kommentare