Die politische Elite in Deutschland – aber auch in fast allen übrigen europäischen Ländern – zieht sich in ihrem mittlerweile von ihr selbst erkannten sachlich-inhaltlichen Versagen gerne darauf zurück, dass Politik die Kunst des Machbaren sei und man schließlich immer Kompromisse schließen müsse, wenn man nicht die absolute Mehrheit im Parlament habe – was aber praktisch seit den 1950er-Jahren nicht mehr vorgekommen ist.
Dies ist die Rückzugslinie, ja die taktische Nebelgranate, mit der vom eigenen radikalen Komplettversagen, aber auch von der eigenen Korruption, Freunderlswirtschaft und Selbstbedienungsmentalität abgelenkt werden soll. Denn die brutale Wahrheit ist: Es sind nicht die Kompromisse, die man sich in der Politik gegenseitig aufzwingt, die zu den bekannten Ergebnissen führen. Vielmehr ist man dem jeweiligen politischen Gegner für dieses Alibi dankbar, in dessen Windschatten man das eigene Interesse über die langfristigen Anliegen der Wähler stellen kann.
Die Betonung liegt auf langfristig. Denn die kurzfristigen Interessen der Wähler werden sehr wohl von der Politik bedient. Ja, sie sind geradezu der Motor, der es der Politik ermöglicht, den Eigennutz der bürokratisch-administrativen Klasse über das Wohl des Volkes zu stellen, weil kurzfristige Bedürfnisbefriedigung und das langfristig Richtige weit auseinanderklaffen. Nachdem alle konventionellen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Gegenwart zulasten der Zukunft zu beleihen und so die kurzfristige Befriedigung über das langfristig Notwendige zu stellen, hat man nun mit dem Nullzins den finalen Punkt der resultierenden Illusionswelt erreicht. Er gaukelt vor, dass es zwischen beiden gar keinen Unterschied gebe.
[inner_post 1] Eine alte Redensart besagt: »Der Mensch ist gut. Aber die Leut san a Gsindel!« In diesem Satz liegt eine tiefe Wahrheit verborgen, die etwas damit zu tun hat, dass der Mensch als Individuum im Leben vorankommt, wenn er seine langfristigen Interessen über seine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung stellt. In der Masse (»die Leut«) tut er das nicht, weil er davon ausgeht, dass die Folgen der kurzfristigen, schnellen Befriedigung nicht zulasten seiner eigenen langfristigen Wohlfahrt gehen, sondern er sie irgendwie auf andere überwälzen kann. Der Einzelne bemerkt das nicht, weil sich die Folgen jedes einzelnen Raubes über das Kollektiv fein verteilen. Gleichzeitig bekommt aber jedes Mitglied der Masse einen Anreiz, es anderen gleichzutun. Die Forderung der Beraubung wird dabei immer und ohne Ausnahme im Namen einer »höheren Moral« erhoben, am Ende zahlt die Zeche aber die schrumpfende Minderheit der Leistungsträger, die es – zu Recht – für unmoralisch hält, ihr Leben auf Kosten anderer zu führen. So führt der moralinsaure Anspruch der Räuber zur Herrschaft der Unmoralischen über die in Wahrheit einzig verbliebenen Moralischen.
Und wenn man die Folgen der von dieser Haltung inspirierten Politik betrachtet, dann geht das Konzept der kollektiven Beraubung ja auch auf – jedenfalls eine Zeit lang. Deshalb agiert der Mensch in der Masse völlig anders, als er es als Individuum tut. Die Masse derationalisiert den Menschen in gewisser Weise. Eine irrationale Ideologie wie der Sozialismus bedient sich daher des Begriffes der Massen, um eine gegen die wahren Interessen der Menschen gerichtete Politik durchsetzen zu können.
Der Mensch agiert in der Masse nicht so, wie er als Individuum agiert. Es lohnt sich, diesen Umstand genauer zu betrachten. Wie wir sehen werden, gibt es eine Beziehung zwischen der menschlichen Freiheit als Individuum, seiner Wahrnehmung der Zeit, daraus folgend dem Zins (!), der Existenz individueller Freiheit, die Unmöglichkeit einer Freiheit der »Masse« und der daraus zwingend folgenden Fehlleitung der politischen Klasse in der von uns so weinselig gepriesenen Parteiendemokratie.
Der Mensch unterscheidet sich vom Tier, basierend auf seinem Intellekt, also seiner Fähigkeit zur Einsicht, durch seine Fähigkeit zum individuell planvollen Handeln. Das Tier hingegen folgt seinem Instinkt, und zwar auch dann, wenn sein Handeln für uns Menschen planvoll erscheint, wie zum Beispiel die Vorratshaltung des Eichhörnchens. Das wirklich planvolle Handeln benötigt jedoch die Erfüllung von zwei Voraussetzungen: erstens die Erkenntnis des Selbst, also das »Cogito, ergo sum« (Ich denke, also bin ich) zur Definition der Zielgerichtetheit des Handelns, und zweitens die Wahrnehmung der Zeit, also das Wissen um die Existenz einer Zukunft, in der unser heutiges Handeln auf unser sich dann einstellendes Wohlbefinden, unsere Existenz, ja unser Überleben und das unserer Nachkommen einen Einfluss hat.
Die Form des uns gegebenen Intellektes ermöglicht durch seine Erkenntnis des Selbst und der Zeit also ein Handeln, welches nicht weniger als die physische Grundlage des freien Willens und damit der Freiheit schlechthin ist.
[inner_post 2] Das Tier hingegen verfügt nicht über diese Fähigkeit. Die Zukunft als Konzept kommt in seiner Gedankenwelt nicht vor. Das Überleben wird ersatzweise durch Instinkthandlungen gesteuert, die die Evolution als geeignete Überlebensstrategien in einem kurz- bis mittelfristig statischen Ökosystem herausgearbeitet hat. Ändern sich die Bedingungen des Ökosystems, so erfolgt das anpassende Lernen nicht durch geistige Leistung, sondern durch einen neuen evolutorischen Selektionsprozess, bei dem Eigenschaften, Verhaltensweisen und Fähigkeiten in einem Prozess von Versuch und Irrtum über mehrere, oftmals sehr viele Generationen hervorgebracht werden. Der Prozess der genetischen Anpassung geht umso schneller vonstatten, je kürzer die Generationenfolge einer Spezies ist. In diesem Wettlauf sind die Insekten klar im Vorteil. Vielleicht ist das der psychologische Grund, warum das marxistische Utopia sich so sehr am Ameisenstaat anlehnt.
Der Irrtum wird von der Evolution mit dem Tod bestraft. Der erfolgreiche Versuch mit dem Überleben belohnt. Auch der Mensch lernt durch Versuch und Irrtum, kann diesen evolutionären Prozess aber dank seines Gehirns innerhalb seiner Lebensspanne durchführen. Er irrt sich, erleidet dadurch Kosten und lernt so. Er irrt sich nicht, erzielt dadurch Gewinn und lernt ebenfalls.
Es ist eine der wichtigsten Lektionen, die das Leben in der endlosen Kette von Versuch und Irrtum dem Menschen erteilt, dass es eine Wahl zwischen kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung und langfristigem Wohlstand und Erfolg gibt. Diese Erkenntnis steht im Widerstreit mit unserer aus der tierischen Vergangenheit ererbten Nutzenfunktion, die die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, den Konsum heute, höher bewertet als die spätere Bedürfnisbefriedigung, also den Konsum morgen, in einem Jahr oder in zehn Jahren.
Ein Kind, das an der Supermarktkasse vor der buchstäblich so genannten »Quengelware« steht und die Schokolade jetzt, sofort, unverzüglich haben möchte, demonstriert uns, wie die Verkaufsstrategen diese menschliche Tendenz ausnutzen in der Hoffnung, dass auch die Mutter die schnelle Befreiung vom kurzfristigen Schmerz des Geschreis nach der Süßigkeit über die langfristige Zahngesundheit ihres Kindes stellt.
Tiere haben diese Form der Zeitpräferenz in exzessiver Form. Mein Hund, wenn er sich Zugang zum Fressvorrat verschaffen kann, wird buchstäblich nicht aufhören zu fressen, bis er schier platzt. Affen, insbesondere Bonobos, sind für ihren »Affenappetit« bekannt. Ihre Nutzenfunktion kennt keine
Abwägung zwischen dem Hier und Jetzt und der Zukunft, weil das Konzept Zukunft jenseits eines sehr kurzen Zeithorizonts im begrenzten Universum des Affen schlicht keinen Platz hat. Die Planungsfähigkeit der Bonobos hat ihre maximale Entfaltung in der Erfahrung, dass die Weibchen dieser Art für das Anbieten von Essen sexuelle Gefälligkeiten erweisen.
[inner_post 3] Wenn es aber einen Konflikt gibt zwischen dem Konsum heute und dem Konsum morgen und wenn der Mensch in der Lage ist, diesen zu begreifen, dann übersetzt sich das planvolle Handeln ganz automatisch in einen Ausgleich zwischen diesen zeitlichen Präferenzen. Auch der planvolle Mensch konsumiert lieber jetzt als morgen, aber er wird bewussten Verzicht üben, um die Konsummöglichkeit für später aufzusparen. Die nicht konsumierten Ressourcen können dann in produktive Anlagen investiert werden, die durch technischen Fortschritt und mit ihm einhergehende immer feinere Verästelung der Arbeitsteilung permanent produktiver werden und so in der Zukunft mehr Güter produzieren, als der Konsumverzicht zunächst benötigt hat. In unserer arbeitsteiligen und daher hochproduktiven Gesellschaft ist dieser Verzicht also mit einer Investition verbunden, die es sogar ermöglicht, durch den Verzicht auf eine Einheit Konsum in der Zukunft mehr als eine Einheit Konsum zu genießen.
Dieser Effekt, der sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer feiner verästelnden Arbeitsteilung ist nichts Geringeres als die Grundlage der menschlichen Zivilisation, weil Arbeitsteilung und Produktivität Hand in Hand gehen.
Die Quelle des Zinses
Daraus folgt: Der Konsumverzicht, in Form von Sparen, verzinst sich. Der Zins setzt Konsum und Zeit in eine preisliche Beziehung und ermöglicht es so den Mitgliedern der Gesellschaft, ebenso planvoll eine Abwägung zu treffen, die heutige und künftige Bedürfnisse ins Gleichgewicht bringt. Diese Preisinformation kann in ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden. Deshalb ist die Existenz des Zinses eine zwingend notwendige Voraussetzung für Sparen und Investieren und damit wiederum für die Verfeinerung der Arbeitsteilung und den menschlichen Fortschritt schlechthin. Es ist daher keine Überraschung, dass Unternehmen bei Nullzinsen weniger Zukunftsinvestitionen tätigen: Ihre existierende Ineffizienz und Unproduktivität im Vergleich zu ihren Möglichkeiten hindert sie nicht am Überleben oder am Erzielen von Gewinn. Dieser Befund steht im diametralen Gegensatz zum keynesianischen Postulat, dass fallende Zinsen Investitionen fördern würden. Das tun sie vor allem bei schlechten Investitionen, die sonst keiner bei Verstand unternehmen würde, wenn das dafür aufgewendete Kapital etwas kostet.

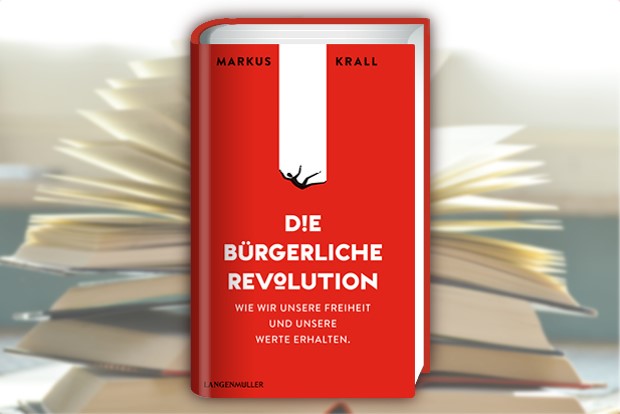
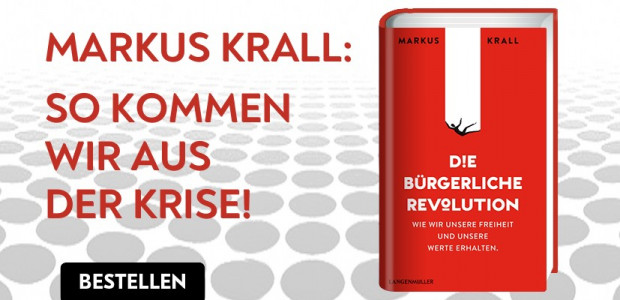





0 Kommentare